Mispeln, Frost und E‑Autos: Bidirektionales Laden
Ist das nun eine passende Metapher für bidirektionales Laden? Jedenfalls hat die BNetzA das Akronym „MiSpEl“ als Namen für das im September gestartete Festlegungsverfahren zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten ausgewählt.
Darum geht es: Durch bidirektionales Laden sollen E‑Fahrzeuge als mobile Speicher zur Energiewende beitragen. Laden aus dem Stromnetz in die Fahrzeugbatteriebatterie und zurück, ins Netz selbst (Vehicle to Grid – V2G), ins Haus oder in Geräte (Vehicle to Everything – V2X): Das Auto als Notstromaggregat, als Schwarmspeicher für Ausgleichsenergie, als Geschäftsmodell – den möglichen Anwendungsfällen wird viel Problemlösungspotential zugesprochen. Doch bisher sind sie meist in Pilotprojekten erprobt, und die rechtlichen Grundlagen entwickeln sich nur langsam.

Während etwa Rückspeisen im Eigenverbrauch als eher unproblematisch gilt, bestehen weiter Hindernisse für V2G-Anwendungen. So konnten E‑Autos als mobile Speicher bisher nicht von finanziellen Entlastungen für stationäre Speicher profitieren (§ 5 Abs. 4 StromStG, § 118 Abs. 6 EnWG). Ein aktueller Gesetzentwurf für das Energie- und Stromsteuerrecht soll das ändern und durchläuft in Kürze die 2. Beratung im Bundestag.
Auch Änderungen im EEG und EnFG durch das sogenannte „Solarspitzengesetz“ (auch „Stromspitzengesetz“) haben Fortschritte gebracht: Bisher war EEG-Förderung nach Zwischenspeicherung nur bei ausschließlicher Nutzung von EE-Strom möglich („Ausschließlichkeitsoption“). Nach den Gesetzesänderungen sollen nun zwei neue Optionen ermöglichen, dass die Förderung auch für gemischte Strommengen (EE- und Netzstrom) anteilig erhalten bleibt. Für die praktische Umsetzung braucht es die Festlegungen der BNetzA. Vorgeschlagen sind eine „Abgrenzungsoption“ und eine „Pauschaloption“. Erstere grenzt EE- und Netzstrom auf Basis viertelstündlicher Messwerte ab; zweitere vereinfacht Annahmen für bestimmte Solaranlagen (bis 30kWp Leistung). Ein konkreter Zeitplan für das MiSpEl-Verfahren fehlt noch, eine zeitnahe Finalisierung der Festlegungen – etwa bis Ende Q1/2026 – wäre aber wünschenswert.
Nicht zuletzt, weil auch die jüngste Studie des Thinktanks Agora Verkehrswende erneut zeigt: Bidirektionales Laden kann Netze entlasten und die Energiewende kostengünstiger machen – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Wer weiß: Vielleicht stimmt ja die MiSpEl-Metapher mit dem Genuss nach dem ersten Frost – dann könnte es schon in wenigen Wochen soweit sein. Wir drücken die Daumen.
(Friederike Pfeifer)
Windparks ohne EEG Förderung?
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien stehen immer wieder mal in der Kritik, weil deren Stromerzeugung, soweit sie nicht dem Eigenverbrauch dient, über das Instrument der Einspeisevergütung oder der Marktprämie staatlich subventioniert werde. Dabei gibt es auch Anlagen von relevanter Größe die inzwischen ohne solche Förderung auskommen.

Es gibt in Deutschland tatsächlich Windparks, die ohne zusätzliche gesetzliche Förderung (also etwa ohne eine garantierte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare‑Energien‑Gesetz – EEG) errichtet worden sind oder so geplant werden.
Der Windpark He Dreiht als derzeit Deutschlands größter Offshore-Windpark nordwestlich der Insel Borkum mit einer Leistung von ca. 900 MW wurde im Rahmen einer Ausschreibung gewonnen mit einem “Null-Bezuschussung”-Gebot: Der Betreiber erklärte, dass keine EEG-Förderung erforderlich sei.Auch bei anderen Offshore-Windprojekten wurde bzw. wird ein Zuschlag ohne Förderanspruch („0 Cent pro kWh“) erteilt. Ein weiteres Projekt, der Offshore-Windpark Windanker in der Ostsee, ist geplant mit einem Zuschlagssatz von 0 Cent/kWh – also auch ohne Förderung.
Diese Fälle betreffen insbesondere Offshore-Windparks (also Windenergieanlagen auf See). Onshore-Windparks (an Land) sind oft noch stärker von Fördermechanismen abhängig oder haben andere Vertragsmodelle.
“Ohne Förderung” bedeutet hier: kein Anspruch auf eine staatliche fixe Einspeisevergütung oder ein ähnliches Fördermodell. Nicht unbedingt: keine finanziellen Risiken oder keine Marktrisiken. Auch wenn kein Fördertarif gewährt wird, bleibt oft eine Marktbeteiligung bzw. Vermarktung über Strommengen- oder PPA-Verträge (Power Purchase Agreements) erforderlich, damit sich das Projekt wirtschaftlich trägt. Der Erfolg bzw. die Wirtschaftlichkeit hängt stark ab von Faktoren wie: Standortqualität (Windaufkommen, Volllaststunden), Finanzierungskosten, Technik- und Industrielernkurven, Netzanschlusskosten etc.
Trotz dieser positiven Beispiele ist das derzeit aber noch nicht automatisch der Standardfall —Fördermodelle spielen weiterhin eine große Rolle im Ausbau der Windenergie.
(Christian Dümke)
Wie weiter mit dem ETS II?
Der Europäische Rat – also das Organ der Mitgliedstaaten der EU – will den EU ETS II um ein Jahr verschieben (siehe hier). Er soll also erst 2028 starten und nicht 2027. Der Grund ist banal: Manchen EU-Regierungen ist der CO2-Preis, der vor allem Erdgas, Heizöl, Diesel‘ und Benzin verteuert, schlicht zu hoch. Sie hoffen teilweise, dass es entweder gar nicht zu den teilweise prognostizierten hohen Preisen kommt oder der ETS II so spät starte, dass der Aufwuchs an klimafreundlichen Technologien wie Wärmepumpe und E‑Auto quasi von selbst zu niedrigeren Preisen führt, um den Volkszorn nicht zu provozieren.
Doch was bedeutet das für die Praxis? Klar ist jedenfalls, dass die aus deutscher Perspektive wünschenswerte Vereinheitlichung sich verzögert. Doch womit müssen deutsche Versorger und Verbraucher rechnen?
Eine mögliche Antwort geben Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) und Brennstoff-Emissionshandelsgesetz (BEHG). Denn der Fall einer Verschiebung ist hier durchaus bereits mitgedacht, aber nicht als letztlich politische Entscheidung, sondern für den Fall, dass die Kommission wegen außergewöhnlich hoher Energiepreise den Startschuss um ein Jahr verschiebt. Dieser – in Art. 30k Emissionshandelsrichtlinie sehr klar umrissene – Fall liegt nicht vor, deswegen kann die Kommission nicht einfach eine Bekanntmachung vornehmen, aber die Situationen sind so ähnlich, dass ein Rückgriff sich anbietet. In diesem Fall suspendiert § 56 TEHG die Abgabepflicht – nicht aber die Berichtspflicht – für Inverkehrbringer nach dem TEHG für das Jahr 2027.
Doch sind die Inverkehrbringer dann aller Sorgen ledig? Mitnichten – denn es gibt ja auch noch das BEHG. Dessen § 24 Abs. 1 BEHG sieht vor, dass nur dann die Verpflichtungen nach dem BEHG zurücktreten, wenn das TEHG greift. Ist das nicht der Fall, gilt das BEHG also weiter.
Doch wie sieht dann die Bepreisung konkret aus? Gibt es feste Preise? Hier sieht § 10 BEHG an sich eine Versteigerung vor, ab 2027 ohne Preisobergrenze. § 10 Abs. 3 Nr. 5 BEHG erlaubt der Bundesregierung aber (wie im Restanwendungsbereich des BEHG) eine abweichende Rechtsverordnung mit einem Festpreisverkauf zum Preis von TEHG-Zertifikaten.
Dies wirft allerdings die Frage auf, wie in diesem Fall mit der Diskrepanz zwischen dem Budget für diesen Sektor und den verkauften Zertifikaten umzugehen ist. Ein weiterer Zukauf würde mindestens sehr teuer, es ist auch fraglich, ob eine solche Regelung wirklich einen wahrnehmbaren Minderungsanreiz ausüben würde. Zudem bereiten DEHSt und EEX schon jetzt die Versteigerung für 2026 vor, die in einem Preiskorridor zwischen 55 und 65 EUR stattfinden soll. Ob angesichts dessen nicht eher ein zweites Jahr nationaler Versteigerungen naheliegt, möglicherweise mit einer realistischeren Obergrenze?
Alle diese Fragen müsste der deutsche Gesetzgeber beantworten. Bevor dies allerdings eintreten kann, muss nun erst einmal auf EU-Ebene geklärt werden, wie es weitergeht. Denn bekanntlich macht der Rat Regelungen nicht allein. Um hier kurzfristig etwas zu ändern, müssen auch Europäisches Parlament und Kommission aktiv werden, die bereits bei der letzten Novelle der Emissionshandelsrichtlinie ihren eigenen Kopf bewiesen haben. Es bleibt also bei einer ärgerlichen Unsicherheit, gerade für Zweijahresverträge, die diese Risiken nun abbilden müssen (Miriam Vollmer).
Alpha Ventus – Pionier der deutschen Offshore-Windenergie
Der Windpark Alpha Ventus gilt als Meilenstein in der Geschichte der deutschen Energiewende. Er war der erste Offshore-Windpark Deutschlands und diente als technologische und wissenschaftliche Testplattform für die Nutzung von Windenergie auf hoher See. Mit seiner Inbetriebnahme begann ein neues Kapitel in der Entwicklung erneuerbarer Energien.
Alpha Ventus liegt rund 45 Kilometer nördlich der Insel Borkum in der Nordsee, auf dem sogenannten „Borkum-Cluster“. Der Standort befindet sich in einer Wassertiefe von etwa 30 Metern, was die Errichtung der Anlagen zu einer ingenieurtechnischen Herausforderung machte. Der Windpark besteht aus zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 60 Megawatt (MW). Errichtet wurden zwei unterschiedliche Anlagentypen: 6 Multibrid M5000-Anlagen (5 MW je Turbine) von Areva/REpower und 6 Adwen/AREVA-Anlagen von Senvion (ehemals REpower). Die Fundamente wurden als Tripod-Konstruktionen im Meeresboden verankert – eine damals neuartige Technik für Offshore-Projekte in dieser Tiefe.

Der Bau begann im Jahr 2008 unter Leitung der Projektgesellschaft Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG (DOTI), einem Konsortium der Energieunternehmen EWE, E.ON und Vattenfall. Die Bauphase war von schwierigen Wetterbedingungen und logistischen Herausforderungen geprägt. Trotzdem wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen – und diente anschließend als Blaupause für viele weitere Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee. Im Jahr 2010 ging Alpha Ventus vollständig ans Netz und speiste erstmals Strom in das deutsche Übertragungsnetz ein.
Alpha Ventus war nicht nur ein Energieprojekt, sondern auch ein groß angelegtes Forschungsfeld. Im Rahmen des RAVE-Programms (Research at Alpha Ventus) wurden zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt – etwa zu Wind- und Wellenverhältnissen, Materialbelastung und Korrosion, Auswirkungen auf Meerestiere, Vögel und Ökosysteme, Betriebssicherheit und Wartung in Offshore-Umgebungen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse trugen maßgeblich dazu bei, die Technik und Wirtschaftlichkeit späterer Offshore-Projekte zu verbessern.
Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 250 Gigawattstunden (GWh) kann Alpha Ventus rechnerisch etwa 70.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Dadurch werden jährlich rund 220.000 Tonnen CO₂ im Vergleich zu fossilen Energiequellen eingespart. Trotz hoher Kosten und technischer Risiken legte das Projekt den Grundstein für eine ganze Industrie.
Das Betreiberkonsortium (EWE, RWE und Vattenfall) hat im Mai 2025 beschlossen, den 60 MW-Windpark nicht weiter in seiner bisherigen Form zu betreiben, sondern auf eine Rückbau-Lösung hinzuarbeiten.Mit dem Programm RAVE („Research at Alpha Ventus“) wird bereits intensiv an Forschung zu diesem End-of-Life-Prozess gearbeitet – das Projekt dient damit nicht nur dem Rückbau, sondern als Lernfeld für die gesamte Branche
(Christian Dümke)
Laufzeitklauseln im Fernwärmeliefervertrag
Apropos Laufzeit. 32 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV bestimmt, dass die Laufzeit von Fernwärmeversorgungsverträgen höchstens zehn Jahre betragen darf. In der Branche ist es weit verbreitet, daraus abzuleiten, dass die Zehnjahresfrist ab Aufnahme der Versorgung zu laufen beginnt. Gesichert ist diese Annahme jedoch keineswegs. Nach der Rechtsprechung des BGH – allerdings allgemein und nicht speziell zu Fernwärmeverträgen – beginnt die Laufzeit eines Vertrages grundsätzlich mit dessen Abschluss und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt der Leistungserbringung (BGH NJW 2013, 926, Rn. 22).
Für Fernwärmelieferverträge ergibt sich hieraus ein Risiko: Beginnt der Vertrag mit Unterzeichnung zu laufen, soll die Zehnjahresfrist aber erst ab Aufnahme der Wärmelieferung gelten, könnte ein besonders kritisches Gericht einen Verstoß gegen § 32 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV annehmen. Denn zwischen der Unterzeichnung und dem avisierten Ende liegt möglicherweise deutlich mehr Zeit als die besagten zehn Jahre. Die Folge wäre konsequent zu Ende gedacht die Unwirksamkeit der Laufzeitklausel. In einem solchen Fall könnte der Kunde unter Umständen ohne die Beschränkungen des § 3 AVBFernwärmeV kündigen, also insbesondere ohne den Nachweis, erneuerbare Energien einzusetzen.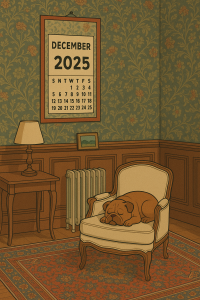
Wie lässt sich diesem Risiko begegnen? Viele vorsichtige Versorger sehen im Fernwärmeliefervertrag ausdrücklich vor, dass die Vertragslaufzeit erst mit Aufnahme der Versorgung beginnt. Die Zehnjahresfrist ist damit gesichert. Allerdings besteht vor Aufnahme der Versorgung dann keine vertragliche Bindung, was insbesondere problematisch sein kann, wenn – wie bei vielen Nahwärmeprojekten, die ja ebenfalls der AVBFernwärmeV unterfallen – bereits vor Versorgungsbeginn gebaut wird oder Baukostenzuschüsse erhoben werden. In solchen Konstellationen führt wohl kein Weg daran vorbei, die Zehnjahresfrist ab Unterzeichnung laufen zu lassen, auch wenn der tatsächliche Versorgungszeitraum dadurch kürzer ausfällt. In jedem Fall sollte die Laufzeitklausel nicht aus branchenüblichen Versorgungsabläufen „übernommen“, sondern auf das konkrete Vertragsverhältnis zugeschneidert werden (Miriam Vollmer).
RESourceEU: Europas Kreislaufwirtschaft als geopolitische Strategie
Es tut sich was in Sachen Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene: Mit der neuen Initiative „RESourceEU“ will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europa unabhängiger von Rohstoffimporten machen – und zieht dabei eine klare Lehre aus der Energiekrise. „Die Welt von heute ist unerbittlich. Und die Weltwirtschaft ist eine völlig andere als noch vor wenigen Jahren. Europa kann nicht länger einfach so weitermachen. Diese Lektion mussten wir bei der Energie schmerzlich lernen. Wir werden bei den kritischen Rohstoffen nicht den gleichen Fehler machen. Deshalb ist es an der Zeit, einen Gang höher zu schalten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ob bei Energie oder Rohstoffen, bei der Verteidigung oder beim Digitalen, Europa muss versuchen, unabhängig zu werden. Und es ist an uns, das genau jetzt zu tun“, sagte sie in ihrer Rede am 25.10.2025 im Rahmen des Berlin Global Dialogue 2025.
Ursula von der Leyen zeichnete ein düsteres Bild der Weltlage, aber dies sollte auch die „Alarmglocken“ schrillen lassen und daher mahnte sie dazu, dass Europa sein geoökonomisches Gewicht zu seinem Vorteil und für seine eigenen Interessen einsetzen müsse. Das sei letztlich der Weg, wie Europa seinen Platz in der heutigen Weltwirtschaft finden könne. „Dies ist eine Abkehr von der traditionellen Vorsicht Europas – denn die Welt von heute belohnt Schnelligkeit, nicht Zögern.“
Fest steht: Die Kreislaufwirtschaft dient nicht nur dem Ressourcenschutz und dem Klimaschutz, sondern dient letztlich auch der nationalen Sicherheit. Die strategische Bedeutung von kritischen Rohstoffen zeigt sich schließlich derzeit ganz akut. Auch hierbei wurde von der Leyen deutlich. China hat die Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden und Batteriematerialien drastisch verschärft – dies trifft auch Europa hart. Umso wichtiger ist es daher, die Kreislaufwirtschaft in Europa zu stärken.

Der Aktionsplan RESourceEU – nach dem Vorbild der Initiative REPowerEU – setzt deshalb auf drei zentrale Säulen: Recycling, Wiederverwendung und strategische Rohstoffversorgung. Ziel ist es, den Rohstoffkreislauf zu schließen – von der effizienteren Nutzung bestehender Materialien über neue Recyclingtechnologien bis hin zum Aufbau europäischer Lieferketten. Damit soll nicht nur die Versorgungssicherheit gestärkt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gesichert werden.
In den kommenden Monaten will die Kommission konkrete Legislativvorschläge vorlegen – etwa zur verpflichtenden Rückgewinnung kritischer Metalle aus Altgeräten und zur Förderung zirkulärer Produktionsmodelle. RESourceEU könnte so zu einem zentralen Baustein des europäischen Green Deal werden – und Europas Antwort auf die Frage, wie Nachhaltigkeit, Souveränität und wirtschaftliche Stärke zusammen gedacht werden können. Ein „Weiter so“ ist tatsächlich keine Option mehr, wie Ursula von der Leyen es zu Recht betonte. (Dirk Buchsteiner)