Ökodesignanforderungen durch die ESPR
Mit der neuen Ökodesign-Verordnung (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) vollzieht die EU im Rahmen des Green Deal einen weiteren Meilenstein mit Blick auf den ambitionierten Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan (Circular Economy action plan – CEAP). Die neue Verordnung wurde am 28.06.2024 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung und damit zum 18.07.2024 in Kraft.

Das Ziel dieses neuen, unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten geltenden Rechtsakts (Systemwechsel von Richtlinie zur Verordnung!) ist kurz wie folgt zu beschreiben: Mittels Mindestanforderungen an die „Umweltverträglichkeit“ von Produkten sollen im Ergebnis weniger Produkte weggeworfen werden. Unternehmen sollen weniger „Müll“ produzieren und auf den Markt bringen. Hierfür sollen Produkte nachhaltiger werden. Betroffen sind nahezu alle Arten von Waren, ausgenommen sind Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel und lebende Organismen sowie Kraftfahrzeuge. Im Vergleich zur Vorgänger-Richtlinie geht es nun um mehr als „nur“ energie- und ressourceneffiziente Produkte: Die EU setzt einen harmonisierten Rahmen für die Festlegung von Anforderungen an bestimmte Produktgruppen hinsichtlich ihrer Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit und fördert damit die Reparierbarkeit von Produkten. Zudem soll das Recycling vereinfacht werden. Ein Problem stellt oft das Vorhandensein chemischer Stoffe dar, die die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien verhindern. Auch hierbei geht es folglich um ein Phase-out von bestimmten Stoffen (siehe auch die Chemikalienstrategie der EU) und um die Substitution.
Ein Knackpunkt der neuen Verordnung ist der digitale Produktpass, als digitale Identität eines physischen Produkts. Hierin sollen Daten aus allen Phasen des Produktlebenszyklus zusammengetragen und ebenso in all diesen Phasen für diverse Zwecke genutzt werden (Design, Herstellung, Nutzung, Entsorgung). Wie eine Strukturierung umweltrelevanter Daten in einem standardisierten, vergleichbaren Format geschehen soll, damit ein Datenaustausch möglich wird, bleibt abzuwarten. Der Testballon des digitalen Batteriepasses soll hier erste Antworten bringen. Zweck des Produktpasses ist es, dem Verbraucher verlässliche Konsumenteninformationen geben, damit Konsumenten nachhaltige Konsumentscheidungen treffen können – und das beginnt nun mal schon beim Design von Produkten. (Dirk Buchsteiner)


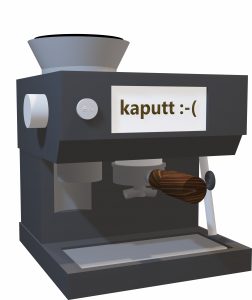 Jeder von uns kennt irgendwie dieses Problem – mal ist es der Toaster oder der Staubsauger. Je teurer das Gerät, desto auffälliger ist es, wenn es dann mal nicht funktioniert. Bei der Kaffeemaschine war es nun besonders schmerzlich. Zwar konnte die
Jeder von uns kennt irgendwie dieses Problem – mal ist es der Toaster oder der Staubsauger. Je teurer das Gerät, desto auffälliger ist es, wenn es dann mal nicht funktioniert. Bei der Kaffeemaschine war es nun besonders schmerzlich. Zwar konnte die