Vorhersehbar und folgenlos? Unfälle mangels sicherer Verkehrsregelung
Es kommt immer wieder vor, dass Bürger vor offensichtlichen Gefahrenstellen im Verkehr warnen, aber die zuständige Behörde untätig bleibt: „Es sei ja noch nichts vorgefallen“, so dass die Grundlage zum Eingreifen fehle, heißt es dann manchmal, was für Betroffene zynisch klingen muss. Wenn es dann zum Unfall kommt, stellt sich die Frage nach der Verantwortung der Behörde und deren Mitarbeiter, sei es Amtshaftung, sei es strafrechtliche Verantwortlichkeit. Manchmal gab es auch Weisungen aus der Politik, die für die Untätigkeit ursächlich waren.
Ein Beispiel ist ein Unfall in Berlin. Eltern, Anwohner und eine Schule hatten bereits Anfang des Jahres vor einer gefährlichen Ampelschaltung auf einem Schulweg gewarnt gehabt. Durch die Staus nach Eröffnung der A100 hatte sich die Situation an der Kreuzung noch einmal verschärft. Wenig später ist ein Kind, das bei grünem Signal die Ampel überquert hatte, von einem Kraftfahrer überfahren und schwer verletzt worden. Nach Auskunft des Tagesspiegel hatten beide, sowohl das Kind als auch der Kraftfahrer offenbar zugleich ein grünes Lichtsignal gesehen.
Nun, um dieses Beispiel seriös zu bewerten, müsste man die Aktenlage kennen. Eine „Ferndiagnose“ würde den Beteiligten, den Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde inklusive, nicht gerecht. Aber allgemein sind die folgenden Fragen durchaus berechtigt:
Müssen Behörden in Fällen haften, in denen sie ihre Aufgabe, den Verkehr zu regeln und Gefahren abzuwehren, nicht richtig wahrnehmen? Wie ist es, wenn sich rechtliche Regeln ändern? Etwa soll neuerdings gemäß § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 6 StVO auf hochfrequentierten Schulwegen oder vor Spielplätzen Tempo 30 angeordnet werden. Das das Ermessen hier stark eingeschränkt ist und die Behörde aufgrund hoher geschützter Verfassungswerte, Leben und körperliche Unversehrtheit, eine Handlungspflicht hat, ergibt sich aus der Verwaltungsvorschrift zur StVO (siehe der Verweis auf „Vision Zero“, zu § 1 Rn 1 sowie zu Zeichen 274, Rn. 13a). Sind Behörden also verantwortlich, wenn sie sich nicht kümmern und sich aufgrund der noch erlaubten zu hohen Geschwindigkeit schwere Unfälle ereignen? Was ist, wenn der Bürgermeister oder der Landrat an so einer Stelle die Behörde anweist, die „Regelgeschwindigkeit“ von 50 km/h auf Vorfahrtsstraßen beizubehalten?

Symbolbild: mehrspurige unübersichtliche Straße mit kreuzendem Fußverkehr und schlechten Lichtverhältnissen
Zunächst einmal ist es grundsätzlich so, dass vom Bundesgerichtshof im Haftungsrecht eine Amtspflicht der Behörde anerkannt ist, darüber zu bestimmen, wo welche Verkehrszeichen und ‑einrichtungen im Interesse und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer anzubringen sind (BGH, 25.04.1985 – III ZR 53/84, Rn. 7). Aus der Verletzung dieser sogenannten Verkehrsregelungspflicht kann eine Amtshaftung nach § 839 BGB folgen. Bei Fahrlässigkeit gilt bei Verletzung von Verkehrsregelungspflichten jedoch das sogenannte Verweisungsprivileg: Der Geschädigte muss sich nach § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB zunächst an andere potentielle Schädiger halten. Erst wenn er dort nicht Ersatz erlangen kann, kommt die Amtshaftung in Frage.
Auch wenn den für die Amtspflichtverletzung persönlich verantwortlichen Beamten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, kommt die Amtshaftung in Frage. Sie können dann auch nach Art. 34 Satz 2 GG in Regress genommen werden. Dies gilt auch für Wahlbeamte auf Zeit wie Oberbürgermeister oder Landräte. Ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Gremien, die in der Regel nicht verbeamtet sind oder nicht in ihrer Eigenschaft als Beamte handeln, sind dagegen nicht regresspflichtig. Es gibt dafür in den Gemeindeordnungen und Kommunalverfassungsgesetzen der Länder keine Grundlage. Insgesamt ist die Rechtsprechung typischerweise zurückhaltend bei der Annahme einer Amtshaftung aufgrund einer verletzten Verkehrsregelungspflicht. Ausgeschlossen ist sie jedoch nicht.
Wir beraten übrigens gerne Straßenverkehrsbehörden und Kommunen, wie sie nach dem reformierten Verkehrsrecht ihren Pflichten nachkommen können und sollten. Amtshaftungsprozessen sollte idealerweise dadurch vorgebeugt werden, dass Unfälle von vornherein vermieden werden. Das schont die Staatskasse und das persönliche Vermögen von Beamten ebenso wie das Leben und Wohlergehen der Verkehrsteilnehmer. (Olaf Dilling)
Rückstellung für den Gasnetzrückbau?
Was wird aus dem 500.000 Kilometer langen deutschen Gasnetz? Bis 2045 muss nach aktueller Rechtslage die netzgebundene Erdgasversorgung in Deutschland abgewickelt werden. Es ist absehbar, dass nur ein kleiner Teil des deutschen Gasnetzes dann einer Umnutzung zugeführt werden kann, also etwa für den Transport von Wasserstoff. Greift der Gesetzgeber nicht ein, muss das Gasnetz möglicherweise zurückgebaut werden, also ausgegraben und entsorgt.
Es ist absehbar, dass diese Maßnahmen hohe Kosten auslösen. Dies wirft die Frage nach Rückstellungen auf. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat deswegen im Sommer 2025 darauf hingewiesen (Stellungnahme hier), dass handelsrechtlich Rückstellungen bereits zu bilden sind, wenn eine Außenverpflichtung besteht und mit einer Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen ist. Damit können Rückstellungen handelsrechtlich bereits früher und in größerem Umfang erforderlich sein, als die Bundesnetzagentur regulatorisch anerkennen will. Diese sieht nämlich im Entwurf RAMEN Gas eine regulatorische Anerkennung der Rückstellungen nur vor, wenn besondere Umstände und konkrete Hinweise darauf vorliegen, dass die Grundstückseigentümer den Rückbau verlangen.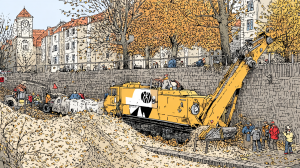
Damit könnte eine Situation entstehen, in der handelsrechtlich Rückstellungen gebildet werden müssen, die aber im Zuge der Netzentgeltberechnung für den Gastransport nicht berücksichtigt werden. Die Gasnetzbetreiber hätten also ein dickes Finanzierungsproblem. In Zeiten ohnehin programmiert sinkender Umsätze könnte dies die Transformation der Wärmewirtschaft weiter belasten.
Für die Unternehmen bedeutet das damit eine Unsicherheit, die eigentlich nur der Gesetzgeber beenden kann. Er muss entweder klar regeln, dass ein Rückbau nur in absoluten Ausnahmefällen infrage kommt. Oder zumindest für einen Gleichlauf handelsrechtlicher und regulatorischer Rückstellungsverpflichtungen sorgen.
Wärmepreise scheitern oft am „Marktelement“
In letzter Zeit häufen sich die gerichtlichen Entscheidungen zu Wärmepreisen und Preisänderungsklauseln in Wärmeversorgungsverträgen. Besonders im Fokus steht dabei das sog. „Marktelement“.
Preisanpassungsklauseln in standardisierten Wärmelieferungsverträgen mit Letzt-verbrauchern, die keine Industriekunden sind, müssen den Anforderungen des § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV genügen um wirksam zu sein. Hierfür ist es erforderlich, dass die Preisanpassungsklausel des Wärmelieferanten sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen (Kostenelement) als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt (Marktelement) angemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren dabei vollständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Das Kostenelement und das Marktelement sind dabei gleichrangig (BGH, Urteil vom 19. 07.2017, Az. VIII ZR 268/15).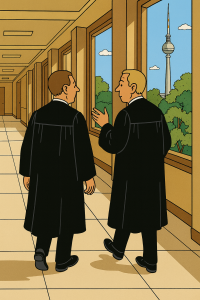
Der zu berücksichtigende Wärmemarkt erstreckt sich dabei auf andere Energieträger, als den tatsächlichen Brennstoff (BGH, 13.07.2011, VIII ZR 339/10). Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich die Gestaltung der Fernwärmepreise „nicht losgelöst von den Preisverhältnissen am Wärmemarkt vollziehen kann“ (BR-Drucks. 90/80, S. 56 [zu § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV aF]).
Und genau daran scheitern derzeit viele Klauseln. Die gewählten Indizes sind zu einseitig und erstrecken sich oft nur auf Erdgas oder wenige ausgewählte Einsatzstoffe. Auch Fehlgewichtungen kommen vor, bei denen das Marktelement zwar vorhanden ist, aber bei der Preisbildung nicht den gleichen Einfluss hat, wie die Brennstoffkosten.
Vor diesem Hintergrund kann jedem Wärmeversorger nur geraten werden, kritisch seine vertraglichen Preisklauseln zu prüfen und ggf. anzupassen.
(Christian Dümke)
„Ohne uns geht’s nicht“ – Bau- und Recyclingbranche fordert politischen Kurswechsel
Zum Auftakt der Fachmesse RecyclingAktiv/TiefbauLive in Karlsruhe haben fünf große Branchenverbände aus Bau‑, Abbruch- und Recyclingwirtschaft ein gemeinsames Positionspapier vorgestellt – mit deutlichen Worten an die Politik. Die zentrale Botschaft: Ohne uns geht es nicht – doch aktuelle Gesetze und bürokratische Hürden machen nachhaltiges Bauen und Recycling zunehmend schwerer.
Im Fokus der Kritik steht natürlich die Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Obwohl sie als Schritt zu bundeseinheitlichen Standards begrüßt wird, beklagen die Verbände ihre realitätsferne Umsetzung: Übermäßige Dokumentationspflichten, fehlende Ausnahmeregelungen für Kleinmengen und Einschränkungen beim Einsatz recycelter Materialien in öffentlichen Ausschreibungen gefährden die Akzeptanz – und damit die gesamte Kreislaufwirtschaft im Bau.
Auch die zunehmenden Brandgefahren durch Lithium-Ionen-Akkus bereiten der Branche große Sorgen. Immer häufiger kommt es zu verheerenden Bränden in Recyclinganlagen – mit Milliardenschäden und einer wachsenden Zurückhaltung der Versicherer. Die Verbände fordern deshalb ein Batteriepfand, ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten sowie mehr Verantwortung von Herstellern.
Gefordert werden zudem:
• Entbürokratisierung von Genehmigungs- und Vergabeverfahren,
• Digitalisierte, standardisierte Prozesse für Schwertransporte,
• Bevorzugung von Sekundärbaustoffen bei öffentlichen Aufträgen,
• Schnelle Nachbesserung der EBV noch 2025.
Trotz der drängenden Themen blieb politische Unterstützung beim Messeauftakt aus – kein Vertreter der Politik war vor Ort. Für die Verbände ein enttäuschendes Signal. Ihre Forderung ist klar: Die Bau- und Recyclingwirtschaft braucht endlich politische Rückendeckung – für mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Diesem Wunsch können wir uns nur anschließen.
(Dirk Buchsteiner)
Warum lassen sich sichere Geh- und Radwege kaum einklagen?
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Eltern oder Betreuern von Menschen mit Bewegungseinschränkung mit folgender Frage: Was lässt sich eigentlich machen, wenn Kinder oder Senioren im Alltag Verkehrsgefahren ausgesetzt sind? Das zugrunde liegende Problem ist der Mangel an sicherer Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr. Entgegen allen Vorurteilen, dass Verkehrswende nur was für elitär-alternative Stadtbewohner sei, betrifft dies sowohl Großstädte wie Berlin oder Bremen als auch Gemeinden im ländlichen Raum.
Auf dem Land fehlen Geh- und Radwege oft gänzlich. Gerade in gebirgigen Orten müssen Kinder oder Senioren mit Gehhilfen zwischen parkenden Autos schmale, kurvige, oft schlecht beleuchtete Fahrbahnen benutzen. Auf Landstraßen müssen Kinder am Fahrbahnrand zur Schule laufen, ohne dass die Geschwindigkeit entsprechend eingeschränkt wird.
In der Stadt gibt es an Straßen mit mehreren Fahrstreifen oft keine sicheren Querungsmöglichkeiten, so dass lange Umwege in Kauf genommen werden müssen. Radwege oder geschützte Radfahrstreifen fehlen an Hauptverkehrsachsen. In Wohnstraßen sind vorhandene Gehwege zugeparkt. Menschen mit Rollstuhl oder Kinder auf Fahrrädern können sie daher nicht nutzen und müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Dies führt an manchen Stellen regelmäßig zu Konflikten durch ungeduldige Autofahrer, die dann die Menschen auf der Fahrbahn bedrängen und beleidigen.

Ghostbike in Frankfurt-Nied (Foto: Wikitarisch, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)
Straßenverkehrsbehörden lehnen in solchen Fällen oft ab, tätig zu werden oder lassen Anfragen gleich unbeantwortet. Wenn sich Betroffene dann an uns wenden, dann müssen wir sie darüber aufklären, dass die Chancen vor Gericht gering sind. Im Übrigen lassen sich die Kosten eines Verfahrens in der Regel nur mit viel Idealismus oder einer solidarischen Finanzierung durch Nachbarn und andere Eltern in Kauf nehmen.
Warum sind die Chancen vor Gericht eigentlich so schlecht? Schließlich dringen auch Kfz-Fahrer immer wieder mit ihren Anliegen vor Gericht durch und können Maßnahmen der Behörden erfolgreich anfechten.
Es gibt dafür unterschiedliche Gründe, aber der wichtigste Grund liegt in der Struktur des Straßenverkehrsrechts und seines Verhältnisses zum Straßenrecht:
Das Straßenrecht setzt im Prinzip den Rahmen, innerhalb dessen sich der Verkehr und die Verkehrsregelung bewegen kann. Im Straßenrecht haben Kommunen oder andere Träger der Straßenbaulast eine relativ große Gestaltungsfreiheit. Wie viel Platz eine Gemeinde bei Planung und Bau von Gemeindestraßen und Plätzen dem Kfz-Verkehr und wie viel sie dem Fuß- und Radverkehr zur Verfügung stellt, ist ihr weitgehend selbst überlassen. Dies ist jedenfalls dann so, wenn sie bei der Neuanlage gewisse Mindeststandards einhält. So ergibt sich etwa für die Mindestbreite von Fahrbahnen oder Sonderwegen aus den technischen Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). Aus guten Gründen können Stadtplaner auch davon in Einzelfällen abweichen, da die Regelwerke nicht rechtsverbindlich sind. Auch nachträglich lässt sich übrigens auf Grundlage des Straßenrechts rechtlich relativ unkompliziert ein Bordstein verlegen, z.B. für sogenannte Gehwegvorstreckungen, um Querungen sicherer zu machen oder auf einer Sperrfläche eine Verkehrsinsel anlegen.
Straßenrechtliche Klagen Einzelner auf Bau eines Geh- oder (Hochbord-)Radwegs oder Einrichtung einer Fußgängerzone werden jedoch regelmäßig an der Klagebefugnis scheitern. Das Straßenrecht betrifft Fragen begrenzter Ressourcen und die planerische Gestaltung des öffentlichen Raums, die kommunalpolitisch zur Disposition stehen sollen. Es ist daher nachvollziehbar, wenn sie kaum mit individuellen Ansprüchen erzwungen werden können.
Doch auch das Straßenverkehrsrecht gibt nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern kaum Möglichkeiten: Wenn die Straße erst einmal baulich eingerichtet und gewidmet ist, dann kann zugunsten des Rad- und Fußverkehrs zwar immer noch der Verkehr durch Verkehrszeichen und ‑einrichtungen geregelt werden. Das betrifft z.B. die Anordnung von geschützten Radfahrstreifen, Fußgängerüberwegen oder Baken, die Fußgänger schützen.
Nach der Logik der StVO haben die Behörden da aber – auch nach der Reform der StVO – nur geringe Spielräume. Denn weiterhin soll der fließende Verkehr nur ausnahmsweise eingeschränkt werden, selbst bei Erleichterungen von der „qualifizierten Gefahrenlage“ nur dann, wenn eine Maßnahme gemäß § 45 Abs. 9 Satz 1 StVO „zwingend erforderlich“ ist und einer Gefahr nicht bereits durch die allgemeinen Regeln der StVO begegnet wird. Da diese Regeln, etwas bei der Vorfahrt oder Benutzung der Fahrbahn, Fußverkehr systematisch benachteiligen, müssen Erleichterungen hart erkämpft werden:
Bei straßenverkehrsrechtlichen Klagen geht es Fußgängern oder den Eltern radfahrender Kinder typischweise darum, Behörden zu Maßnahmen zu verpflichten. Das unterscheidet sie von Autofahrern, die gegen Verkehrsbeschränkungen oder ‑verbote klagen oder auch von Radfahrern, die gegen die Anordnung der Benutzungspflicht eines Radweges vorgehen. Diese Verpflichtungsklagen sind in zweierlei Hinsicht anspruchsvoller als Klagen, mit denen eine belastende Maßnahme angefochten wird:
- Zum einen ist die Klagebefugnis in der Verpflichtungskonstellation nur dann gegeben, wenn die Rechtsnorm, auf die sich die Kläger berufen, eine Schutzwirkung entfaltet. Die Norm darf dabei nicht bloß dem Schutz der Allgemeinheit dienen, sondern einer bestimmten, individualisierbaren Gruppe von Berechtigten. Im Verkehrsrecht sind das typischerweise bloß die Anlieger einer Straße oder andere Personen, die zwingend darauf angewiesen sind, genau diesen Straßenabschnitt zu nutzen. Nur dann kann ein Verkehrsteilnehmer seinen Anspruch vor Gericht verfolgen – und er ist auch nur darauf gerichtet, dass die Behörde ihr Ermessen pflichtgemäß und unter Berücksichtigung der rechtlichen Grenzen ausübt.
- Das heißt, zum anderen wiederum, dass der „objektive“ Nachweis möglich sein muss, dass eine konkrete Gefahr besteht, aufgrund derer die Straßenverkehrbehörde eingreifen musste. Dabei kann die Behörde unter verschiedenen Maßnahmen wählen. Nur wenn alle anderen Maßnahmen ungeeignet sind (oder stärker in Rechte Dritter eingreifen) kann das Gericht zur vom Kläger gewünschten Maßnahme verpflichten.
Tl;dr: Die Regeln des Verkehrsrechts sind primär für den Kraftfahrzeugverkehr gemacht. Jede Verbesserung und Erleichterung für den nicht-motorisierten Verkehr wird aus verkehrsrechtlicher Sicht daher als „Beschränkung“ oder „Verbot“ geframed, das begründungsbedürftig ist. Die Reform der StVO hat zwar Kommunen und Behörden größere Spielräume gegeben, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Deswegen lassen sich Maßnahmen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs jedoch nicht unbedingt besser rechtlich erzwingen. Dies ist dann ein Problem, wenn Kommunen oder Behörden nicht willens und in der Lage sind, die Verkehrssicherheit ihrer eigenen Bürger zu gewährleisten. (Olaf Dilling)
Was kommt nach der Bandlast?
Im „alten“ Stromnetz waren Bandlastkunden super (Stammleser noch aus 2018 kennen unsere Air Vollmer): Wer möglichst gleichmäßig möglichst viel Strom bezog, entlastete das Netz, und dieser Vorteil wurde durch deutlich abgesenkte Netzentgelte an ihn weitergegeben. Doch mit dem steigenden Anteil volatiler Einspeisung relativiert sich der Wert der Bandlast. Die Bundesnetzagentur hat deswegen im Zuge ihrer generellen Neuregelung der Netzentgelte (diesmal heißt das Baby „AgNeS“) ganz aktuell ein Diskussionspapier vorgelegt, das die Grundlage für eine Reform der Netzentgelte für stromintensive Unternehmen bilden soll. Ziel ist es, die bestehenden Sonderregelungen – insbesondere § 19 Absatz 2 StromNEV – so neu zu fassen, dass die großen Verbraucher künftig flexibler und damit netzdienlicher beziehen. Denn angesichts der Herausforderungen der Energiewende und der zunehmenden Bedeutung von Flexibilität im Stromverbrauch, reichen die bisherigen, rein verbrauchsorientierten Rabattmodelle nicht mehr aus. Künftig sollen Netzentgeltprivilegien nicht mehr allein an hohe Stromabnahmen geknüpft sein, sondern an systemdienliche Gegenleistungen wie flexible Lastanpassung. Im Mittelpunkt des nun vorgelegten Diskussionspapiers stehen deswegen drei Modellvorschläge, die diesen Leitgedanken folgen:

Modell 1: Spotmarktorientierte Flexibilitätsanreize
Dieses Modell setzt auf die Kopplung von Verbrauchsverhalten an Preisentwicklungen am Strommarkt. Unternehmen sollen in Zeiten hoher Spotmarktpreise ihren Verbrauch senken und bei niedrigen Preisen erhöhen. Grundlage für eine Belohnung ist die Abweichung vom typischen Verbrauchsverhalten (z. B. einem Tagesdurchschnitt). So sollen Unternehmen finanzielle Anreize erhalten, flexibel auf Marktsignale zu reagieren – was zugleich auch das Gesamtsystem entlastet. Das Modell verspricht hohe Marktintegration, stellt aber auch Anforderungen an Prognosefähigkeit, Messinfrastruktur und die Bereitschaft, kurzfristig zu reagieren.
Modell 2: Zeitlich definierte Lastfenster
In diesem Modell definieren die Netzbetreiber bestimmte Zeiträume, in denen eine Reduktion oder Verlagerung des Stromverbrauchs besonders netzdienlich ist, etwa zur Vermeidung von Engpässen. Unternehmen, die ihren Verbrauch gezielt in diesen Fenstern anpassen, qualifizieren sich für Netzentgeltvergünstigungen. Dieses Modell erlaubt eine bessere Steuerbarkeit aus Netzsicht und eröffnet Unternehmen planbare Handlungsspielräume. Es setzt allerdings eine enge Koordination zwischen Netzbetreibern und Verbrauchern voraus und funktioniert nur mit transparenten Regeln für die Festlegung dieser Zeitfenster.
Modell 3: Netzbetreiberinitiierte Lastanpassung
Im dritten Modell hat der Netzbetreiber den Hebel in der Hand. Er kann im Bedarfsfall gezielt Lastanpassungen bei privilegierten Unternehmen anfordern. Nur wer auf solche Anforderungen reagiert – etwa durch kurzfristige Lastreduktion oder Verschiebung – zahlt ein reduziertesNetzentgelt. Dieses Modell verspricht eine besonders hohe Systemwirksamkeit, da Lastanpassungen genau dort erfolgen, wo sie gebraucht werden. Es ist aber technisch und vertraglich am komplexesten, da eine zuverlässige Kommunikation, Überwachung und Bewertung erforderlich ist.
Statt pauschaler Rabatte für gleichmäßigen Stromverbrauch sollen damit künftig nur noch solche Unternehmen entlastet werden, die einen echten Beitrag zur Netzstabilität leisten. Dies entspricht nicht nur energiewirtschaftlichen Zielen, sondern auch europarechtlichen Vorgaben: Ausnahmen beim Netzentgelt müssen durch eine Gegenleistung gerechtfertigt sein.
Nun ist die Öffentlichkeit gefragt. Bis zum 21.10.2025 kann zum Diskussionspapier Stellung genommen werden (Miriam Vollmer).