Aktionsplan Kreislaufwirtschaft
Nun tut sich wohl doch was in Sachen Kreislaufwirtschaft:
Das Bundesumweltministerium hat mit dem Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft einen konkreten Schritt zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) vorgestellt. Ziel ist es, kurzfristig Maßnahmen zu realisieren, mit denen bis Ende 2027 substanzielle Fortschritte beim Schließen von Stoffkreisläufen erzielt werden sollen. Kern ist, den Verbrauch von Primärrohstoffen zu senken, die Ressourceneffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die ökologische und wirtschaftliche Resilienz Deutschlands zu stärken.
Zu den wichtigsten Maßnahmen des Programms gehören unter anderem die Reform gesetzlicher Regelungen wie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Ersatzbaustoffverordnung (wir dürfen gespannt sein!) sowie Anpassungen im Verpackungsgesetz (nun ja, wir müssen auch die EU-Verpackungsverordnung berücksichtigen), um den Einsatz von Rezyklaten zu erleichtern und verbindlicher zu gestalten. Dazu gehört auch eine Stärkung der öffentlichen Beschaffung als Hebel: Ausschreibungen sollen früher und stärker ökologische und kreislauforientierte Kriterien enthalten. Wir brauchen z.B. weniger Angst vor MEB!
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Digitalisierung und Informationsinfrastruktur. Das Programm sieht unter anderem vor, ein Circular Economy Information System (CEIS) aufzubauen sowie Produktpässe und Datenräume zur Nachverfolgung von Stoff‑ und Warenströmen zu entwickeln. Mit solchen digitalen Instrumenten sollen Prozesse transparenter, Kreisläufe effizienter und Innovationen beschleunigt werden.
Förderprogramme und Innovationsanreize sind zentrale Bausteine: Geplant sind Pilot‑ und Demonstrationsprojekte, insbesondere bei kritischen und strategischen Rohstoffen sowie bei Recyclingverfahren etwa für Batterien oder Photovoltaikmodule. Auch der Mittelstand soll gezielt unterstützt werden. Zudem sind Maßnahmen zur Beratung, Vernetzung und Qualifizierung in Planung sowie ein Ausbau der Kapazitäten in Recycling und Infrastruktur.
Die Reaktionen aus der Branche zeigen ein geteiltes Bild: Viele begrüßen das Programm als wichtigen Impuls, etwa im Bereich Digitalisierung oder Förderung. Gleichwohl wird bemängelt, dass Verbindlichkeit und Tempo noch nicht ausreichen. Kritikpunkte sind unter anderem fehlende Rezyklatquoten, zu langsame Genehmigungverfahren und unklare Rechtsrahmen. Es wird erwartet, dass aus den angekündigten Maßnahmen bald konkrete gesetzliche Schritte werden, die Planungssicherheit und Investitionsanreize bieten.
Entscheidend wird sein, ob die Zusagen in praktikable Regelungen überführt werden und wie schnell Erweiterungen und Anpassungen erfolgen, und ob sich dann auch Behörden, Wirtschaft und Kommunen gemeinsam auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen.
(Dirk Buchsteiner)
Der Hamburger Hafen auf dem Weg zur Klimaneutralität
Die Stadt Hamburg hat über den zukünftigen Klimaschutz der Stadt abgestimmt. Bei dem Volksentscheid „Hamburger Zukunftsentscheid“ am 12. Oktober haben 53,2 % der gültig abgegebenen Stimmen für eine verschärfte Klimapolitik gestimmt, 46,8 % dagegen. Damit wurde entschieden, das Zieljahr für die Klimaneutralität der Stadt von 2045 auf 2040 vorzuziehen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 43,6 % der Stimmberechtigten.
Aber kann eine Stadt wie Hamburg, inbesondere mit dem dortigen Überseehafen als einem der größten Seehäfen Europasüberhaupt klimaneurtal werden?

Davon geht zumindest die hafeneigene Planung – auch schon vor dem Volksentscheid – aus. Bis spätestens 2040 soll ein Großteil der Hafenaktivitäten klimaneutral werden. Stadt, Hafenbetriebe und Logistikunternehmen haben dazu eine Vielzahl von Projekten und Strategien gestartet, um den Energieverbrauch zu senken, Emissionen zu vermeiden und erneuerbare Energien in den Betrieb zu integrieren.
Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), das größte Hafenunternehmen der Stadt, hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Bis 2030 will die HHLA ihre CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2018 halbieren – und bis 2040 vollständig klimaneutral arbeiten. Ein Leuchtturmprojekt ist dabei das Container Terminal Altenwerder (CTA), das weltweit als erste klimaneutrale Umschlaganlage zertifiziert wurde.Dort kommen vollelektrische Containertransporter und automatisierte Anlagen zum Einsatz, die mit Ökostrom betrieben werden. Zudem testet die HHLA im Rahmen des Projekts „Clean Port & Logistics“ den Einsatz von Wasserstoff in Hafenlogistik und Transport, um fossile Brennstoffe langfristig zu ersetzen.
Der Hamburger Senat hat zudem festgelegt, dass alle öffentlichen Unternehmen – zu denen auch die Hamburg Port Authority (HPA) zählt – ab 2024 Treibhausgasbilanzen erstellen und Klimastrategien mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 entwickeln müssen.Der Hafen ist dabei ein Schlüsselbereich: Als logistisches Drehkreuz mit Energie‑, Industrie- und Verkehrsinfrastruktur trägt er wesentlich zu den CO₂-Emissionen der Stadt bei. Entsprechend hat die HPA Projekte wie den „Sustainable Energy Hub Hamburg“ gestartet, um grüne Energieträger wie Wasserstoff, Biogas und synthetische Kraftstoffe im Hafen anzusiedeln.
Hamburg sieht im Wasserstoff den zentralen Energieträger der Zukunft. Mehrere Unternehmen im Hafen testen bereits Brennstoffzellenfahrzeuge, Wasserstofftankstellen und Elektrolyse-Anlagen. Der Hafen soll sich so zu einem Knotenpunkt für den Import, die Lagerung und den Umschlag von grünem Wasserstoff entwickeln – nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für die Industrie im Norden Deutschlands.
Parallel dazu investiert der Hafen in Landstromanlagen, um Schiffen während der Liegezeiten eine emissionsfreie Energieversorgung zu ermöglichen. Ziel ist, dass möglichst viele Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe künftig mit Strom statt mit Dieselgeneratoren versorgt werden. Ergänzt wird das durch den Ausbau alternativer Kraftstoffe wie LNG und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um Logistikprozesse effizienter und energiesparender zu gestalten.
Der Weg zur Klimaneutralität des Hamburger Hafens ist so gesehen bei näherer betrachtung kein einzelnes Vorhaben, sondern eine Gemeinschaftsaufgabe: Neben der HHLA und der HPA sind zahlreiche Spediteure, Terminalbetreiber, Reedereien und Energieunternehmen beteiligt. Viele dieser Akteure haben eigene Klimastrategien entwickelt, die sich an den Zielen der Stadt orientieren.
Mit seinen ehrgeizigen Zielen und konkreten Projekten gehört Hamburg auf jeden Fall zu den Vorreitern unter den europäischen Seehäfen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Doch der Weg ist noch weit: Neben technischen Herausforderungen wird es darauf ankommen, die Energieversorgung konsequent auf erneuerbare Quellen umzustellen und Investitionen langfristig zu sichern.
Wenn alle geplanten Maßnahmen greifen, könnte der Hamburger Hafen ab 2040 nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein Symbol für nachhaltige Hafenwirtschaft werden.
(Christian Dümke)
Scheitert Reiches Kraftwerksstrategie?
Die Idee, neue Gaskraftwerke zu bauen, ist ja nicht neu. Schon die Ampelregierung wollte kurzfristig Förderungen für fünf Gigawatt (GW) Gaskraftwerke für die Versorgungssicherheit sowie weitere sieben GW H2-ready Gaskraftwerke ausschreiben. Dies hatte das Wirtschaftsministerium unter Habeck mit der Europäischen Kommission verhandelt. Der Plan scheiterte jedoch an der damaligen Opposition: Die CDU war überzeugt, eine bessere Kraftwerksstrategie aufsetzen zu können. Ein KWSG wurde noch konsultiert, aber nicht mehr beschlossen.
Schnell wurde deutlich, dass das neue Wirtschaftsministerium unter Reiche deutlich mehr Kapazitäten ausschreiben will. Statt zwölf GW sollen bis 2030 nun 20 GW Gaskraftwerksleistung gebaut werden. Es soll dabei nicht nur um Versorgungssicherheit gehen, sondern auch um eine Dämpfung der Preise durch eine Vergrößerung des Angebots. Außerdem will die aktuelle Bundesregierung keine zwingende Umstellung auf Wasserstoff zur Voraussetzung der Förderung machen. Darüber hinaus sollen nicht nur die netztechnisch sinnvollen Standorte im Süden besonders gefördert werden, sondern auch solche im Osten.
Ging die neue Bundesregierung zu Beginn noch recht optimistisch davon aus, dass die Ausschreibungen noch im laufenden Jahr starten könnten, hakte es schnell in Brüssel. Denn Beihilfen unterliegen der Kontrolle durch die Europäische Kommission – und diese sieht die Pläne offenbar kritisch. Nun hat die Deutsche Umwelthilfe die Kanzlei K & L Gates damit beauftragt, zu prüfen, ob die Kommission sich zu Recht querstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es wohl schwierig werden dürfte, sich hier gegen die Kommission durchzusetzen.
Eine Beihilfe sei nur genehmigungsfähig, wenn die Förderung aufgrund eines Marktversagens erforderlich sei und wenn sie geeignet, technologieoffen, angemessen und transparent ausgestaltet werde. In dieser Hinsicht zeigen sich die Gutachter skeptisch. Ein nationales Marktversagen liege schon dann nicht vor, wenn andere europäische Mitgliedstaaten über ausreichende Überkapazitäten verfügten. Zudem sei der Plan des Wirtschaftsministeriums nicht technologieoffen genug. Es sei nämlich nicht belegt, dass die zusätzliche Leistung ausschließlich durch Gaskraftwerke aufgebracht werden könne; Großbatterien, Speicher und andere Formen der Flexibilisierung seien nicht ausreichend geprüft worden. Die Gutachter sehen entsprechend keine evident stichhaltigen Gründe dafür, dass ausgerechnet Gas eingesetzt werden müsse. In Hinblick auf das Verfahren sei zudem problematisch, dass das Ministerium offenbar konkrete standortbezogene Zusagen formuliert, statt die Kapazitäten wettbewerblich und transparent auszuschreiben. Generell zeigen sich die Gutachter nicht überzeugt, dass durch eine so große Zahl neuer Kraftwerke keine übermäßigen negativen Auswirkungen auf Wettbewerb und Handel in der EU entstehen würden. 
Diese Argumente sind alles andere als an den Haaren herbeigezogen. Die Beihilfenprüfung dient dem Schutz des europäischen Wettbewerbs und soll nationale Alleingänge zur Förderung heimischer Unternehmen gerade verhindern. Der Aufbau von Erzeugungskapazitäten, der durch großzügige Förderung Anbieter aus Deutschlands Nachbarländern aus dem Markt drängen könnte, ist daher problematisch. Auch die anderen Bedenken erscheinen logisch. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Kommission die geänderten Pläne der neuen Bundesregierung so noch durchwinkt. Mindestens eine lange Auseinandersetzung und eine erhebliche Anpassung der Strategie werden wohl erforderlich sein, um überhaupt ausschreiben zu können.
Dieses mögliche Scheitern des Plans betrifft viele Akteure. Für die Betreiber geplanter Anlagen ist der verspätete Start Gift. Denn wegen der absehbaren Minderung des Erdgaseinsatzes mit dem Ziel null in 2045 ist das Zeitfenster, in dem mit diesen Kraftwerken Gewinne erzielt werden können, kurz und nicht beliebig nach hinten verlängerbar, wenn die Kraftwerke nicht – wie ursprünglich von der Ampel vorgesehen – auf Wasserstoff umgerüstet werden. Für diejenigen, die Batteriespeicher errichten, könnte die Investition zumindest teilweise entwertet werden, wenn der Staat durch subventionierte Anlagen die Marktparameter im Bereich der Systemdienstleistungen verschiebt. Und klar ist: Sollte es so kommen, wären die Letztverbraucher die großen Verlierer – die Netzstabilitätsmaßnahmen kämen riskant spät, und die Kapazitäten, die keiner braucht, müssten trotzdem finanziert werden (Miriam Vollmer).
Vorhersehbar und folgenlos? Unfälle mangels sicherer Verkehrsregelung
Es kommt immer wieder vor, dass Bürger vor offensichtlichen Gefahrenstellen im Verkehr warnen, aber die zuständige Behörde untätig bleibt: „Es sei ja noch nichts vorgefallen“, so dass die Grundlage zum Eingreifen fehle, heißt es dann manchmal, was für Betroffene zynisch klingen muss. Wenn es dann zum Unfall kommt, stellt sich die Frage nach der Verantwortung der Behörde und deren Mitarbeiter, sei es Amtshaftung, sei es strafrechtliche Verantwortlichkeit. Manchmal gab es auch Weisungen aus der Politik, die für die Untätigkeit ursächlich waren.
Ein Beispiel ist ein Unfall in Berlin. Eltern, Anwohner und eine Schule hatten bereits Anfang des Jahres vor einer gefährlichen Ampelschaltung auf einem Schulweg gewarnt gehabt. Durch die Staus nach Eröffnung der A100 hatte sich die Situation an der Kreuzung noch einmal verschärft. Wenig später ist ein Kind, das bei grünem Signal die Ampel überquert hatte, von einem Kraftfahrer überfahren und schwer verletzt worden. Nach Auskunft des Tagesspiegel hatten beide, sowohl das Kind als auch der Kraftfahrer offenbar zugleich ein grünes Lichtsignal gesehen.
Nun, um dieses Beispiel seriös zu bewerten, müsste man die Aktenlage kennen. Eine „Ferndiagnose“ würde den Beteiligten, den Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde inklusive, nicht gerecht. Aber allgemein sind die folgenden Fragen durchaus berechtigt:
Müssen Behörden in Fällen haften, in denen sie ihre Aufgabe, den Verkehr zu regeln und Gefahren abzuwehren, nicht richtig wahrnehmen? Wie ist es, wenn sich rechtliche Regeln ändern? Etwa soll neuerdings gemäß § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 6 StVO auf hochfrequentierten Schulwegen oder vor Spielplätzen Tempo 30 angeordnet werden. Das das Ermessen hier stark eingeschränkt ist und die Behörde aufgrund hoher geschützter Verfassungswerte, Leben und körperliche Unversehrtheit, eine Handlungspflicht hat, ergibt sich aus der Verwaltungsvorschrift zur StVO (siehe der Verweis auf „Vision Zero“, zu § 1 Rn 1 sowie zu Zeichen 274, Rn. 13a). Sind Behörden also verantwortlich, wenn sie sich nicht kümmern und sich aufgrund der noch erlaubten zu hohen Geschwindigkeit schwere Unfälle ereignen? Was ist, wenn der Bürgermeister oder der Landrat an so einer Stelle die Behörde anweist, die „Regelgeschwindigkeit“ von 50 km/h auf Vorfahrtsstraßen beizubehalten?

Symbolbild: mehrspurige unübersichtliche Straße mit kreuzendem Fußverkehr und schlechten Lichtverhältnissen
Zunächst einmal ist es grundsätzlich so, dass vom Bundesgerichtshof im Haftungsrecht eine Amtspflicht der Behörde anerkannt ist, darüber zu bestimmen, wo welche Verkehrszeichen und ‑einrichtungen im Interesse und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer anzubringen sind (BGH, 25.04.1985 – III ZR 53/84, Rn. 7). Aus der Verletzung dieser sogenannten Verkehrsregelungspflicht kann eine Amtshaftung nach § 839 BGB folgen. Bei Fahrlässigkeit gilt bei Verletzung von Verkehrsregelungspflichten jedoch das sogenannte Verweisungsprivileg: Der Geschädigte muss sich nach § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB zunächst an andere potentielle Schädiger halten. Erst wenn er dort nicht Ersatz erlangen kann, kommt die Amtshaftung in Frage.
Auch wenn den für die Amtspflichtverletzung persönlich verantwortlichen Beamten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, kommt die Amtshaftung in Frage. Sie können dann auch nach Art. 34 Satz 2 GG in Regress genommen werden. Dies gilt auch für Wahlbeamte auf Zeit wie Oberbürgermeister oder Landräte. Ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Gremien, die in der Regel nicht verbeamtet sind oder nicht in ihrer Eigenschaft als Beamte handeln, sind dagegen nicht regresspflichtig. Es gibt dafür in den Gemeindeordnungen und Kommunalverfassungsgesetzen der Länder keine Grundlage. Insgesamt ist die Rechtsprechung typischerweise zurückhaltend bei der Annahme einer Amtshaftung aufgrund einer verletzten Verkehrsregelungspflicht. Ausgeschlossen ist sie jedoch nicht.
Wir beraten übrigens gerne Straßenverkehrsbehörden und Kommunen, wie sie nach dem reformierten Verkehrsrecht ihren Pflichten nachkommen können und sollten. Amtshaftungsprozessen sollte idealerweise dadurch vorgebeugt werden, dass Unfälle von vornherein vermieden werden. Das schont die Staatskasse und das persönliche Vermögen von Beamten ebenso wie das Leben und Wohlergehen der Verkehrsteilnehmer. (Olaf Dilling)
Rückstellung für den Gasnetzrückbau?
Was wird aus dem 500.000 Kilometer langen deutschen Gasnetz? Bis 2045 muss nach aktueller Rechtslage die netzgebundene Erdgasversorgung in Deutschland abgewickelt werden. Es ist absehbar, dass nur ein kleiner Teil des deutschen Gasnetzes dann einer Umnutzung zugeführt werden kann, also etwa für den Transport von Wasserstoff. Greift der Gesetzgeber nicht ein, muss das Gasnetz möglicherweise zurückgebaut werden, also ausgegraben und entsorgt.
Es ist absehbar, dass diese Maßnahmen hohe Kosten auslösen. Dies wirft die Frage nach Rückstellungen auf. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat deswegen im Sommer 2025 darauf hingewiesen (Stellungnahme hier), dass handelsrechtlich Rückstellungen bereits zu bilden sind, wenn eine Außenverpflichtung besteht und mit einer Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen ist. Damit können Rückstellungen handelsrechtlich bereits früher und in größerem Umfang erforderlich sein, als die Bundesnetzagentur regulatorisch anerkennen will. Diese sieht nämlich im Entwurf RAMEN Gas eine regulatorische Anerkennung der Rückstellungen nur vor, wenn besondere Umstände und konkrete Hinweise darauf vorliegen, dass die Grundstückseigentümer den Rückbau verlangen.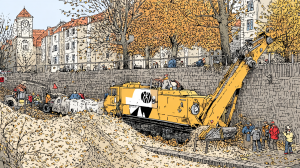
Damit könnte eine Situation entstehen, in der handelsrechtlich Rückstellungen gebildet werden müssen, die aber im Zuge der Netzentgeltberechnung für den Gastransport nicht berücksichtigt werden. Die Gasnetzbetreiber hätten also ein dickes Finanzierungsproblem. In Zeiten ohnehin programmiert sinkender Umsätze könnte dies die Transformation der Wärmewirtschaft weiter belasten.
Für die Unternehmen bedeutet das damit eine Unsicherheit, die eigentlich nur der Gesetzgeber beenden kann. Er muss entweder klar regeln, dass ein Rückbau nur in absoluten Ausnahmefällen infrage kommt. Oder zumindest für einen Gleichlauf handelsrechtlicher und regulatorischer Rückstellungsverpflichtungen sorgen.
Wärmepreise scheitern oft am „Marktelement“
In letzter Zeit häufen sich die gerichtlichen Entscheidungen zu Wärmepreisen und Preisänderungsklauseln in Wärmeversorgungsverträgen. Besonders im Fokus steht dabei das sog. „Marktelement“.
Preisanpassungsklauseln in standardisierten Wärmelieferungsverträgen mit Letzt-verbrauchern, die keine Industriekunden sind, müssen den Anforderungen des § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV genügen um wirksam zu sein. Hierfür ist es erforderlich, dass die Preisanpassungsklausel des Wärmelieferanten sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen (Kostenelement) als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt (Marktelement) angemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren dabei vollständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Das Kostenelement und das Marktelement sind dabei gleichrangig (BGH, Urteil vom 19. 07.2017, Az. VIII ZR 268/15).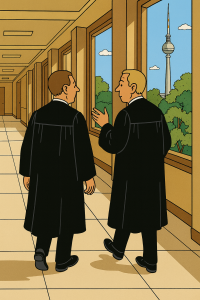
Der zu berücksichtigende Wärmemarkt erstreckt sich dabei auf andere Energieträger, als den tatsächlichen Brennstoff (BGH, 13.07.2011, VIII ZR 339/10). Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich die Gestaltung der Fernwärmepreise „nicht losgelöst von den Preisverhältnissen am Wärmemarkt vollziehen kann“ (BR-Drucks. 90/80, S. 56 [zu § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV aF]).
Und genau daran scheitern derzeit viele Klauseln. Die gewählten Indizes sind zu einseitig und erstrecken sich oft nur auf Erdgas oder wenige ausgewählte Einsatzstoffe. Auch Fehlgewichtungen kommen vor, bei denen das Marktelement zwar vorhanden ist, aber bei der Preisbildung nicht den gleichen Einfluss hat, wie die Brennstoffkosten.
Vor diesem Hintergrund kann jedem Wärmeversorger nur geraten werden, kritisch seine vertraglichen Preisklauseln zu prüfen und ggf. anzupassen.
(Christian Dümke)