Radfahrverbote auf Wald- und Wanderwegen
Auf Radtouren durch Wald und Feld stößt man mitunter auf Wege, die für das Radfahren gesperrt sind. Unter welchen Voraussetzungen ist das eigentlich seitens der Grundstückseigentümer oder der örtlichen Behörden zulässig? Gelten die selben Regeln wie auf Straßen?
Bei vielen Wald- oder Feldwegen handelt es sich um Wege, die über Privateigentum verlaufen. Welche Rechte haben Eigentümer, ihre Benutzung einzuschränken? Tatsächlich ist dieses Recht aufgrund der Sozialpflichtigkeit des Eigentums in Deutschland selbst in vielen Fällen eingeschränkt. So können auch Straßen im Privateigentum öffentlich gewidmet sein oder es können gewohnheitsrechtliche Wegerechte bestehen. Dann gilt grundsätzlich das Recht auf Gemeingebrauch, das nur durch die Straßenverkehrsordnung eingeschränkt werden kann. Das heißt, eine Sperrung für Radfahrer setzt voraus, dass eine qualifizierte Gefahr nachgewiesen werden kann. Dies ist in Deutschland in aller Regel sehr anspruchsvoll und rechtlich angreifbar.
Daneben gibt es in der sogenannten freien Landschaft auch das naturschutzrechtliche Betretungsrecht nach § 59 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Damit ist gemeint, dass Felder und Wiesen auf Straßen und Wegen und auf ungenutzten Flächen zur Erholung betreten werden dürfen. Nun heißt „betreten“ nicht „befahren“, so dass aus dem BNatSchG nicht unmittelbar ein Anspruch für Fahrradfahrende folgt. Allerdings wurde das Betretensrecht von einigen Landesnaturschutzgesetzen ausdrücklich auf das Radfahren und Reiten auf Straßen und Wegen ausgeweitet. Also darf dort auch auf einem Feldweg das Radfahren nicht ohne weiteres verboten werden. Nur in Bundesländern, die in ihrem Naturschutzgesetzen keine solche Regelung haben, gibt es keinen Anspruch mit dem Rad auf Feldwegen zu fahren.
Das Recht auf Erholung im Wald ergibt sich aus dem Bundeswaldgesetz. Das Betreten des Waldes ist demnach grundsätzlich nach § 14 Abs. 1 S. 1 BWaldG gestattet. Fahrradfahren, das Befahren mit Krankenrollstühlen und Reiten ist auf Straßen und Wegen im Wald erlaubt. Auch hier können Forstbesitzer nur ausnahmsweise, etwas bei laufenden Forstarbeiten oder aus Naturschutzgründen Ausnahmen vorsehen. Ausnahmen gibt es auch im direkten Umfeld von Wohnhäusern. Sie dürfen aber Waldwege nicht einfach für die Öffentlichkeit sperren. Dies gilt wie gesagt auch bei straßenverkehrsrechtlichen Verboten. Sie sind nur dann zulässig, wenn eine qualifizierte Gefahr besteht (vgl. z.B. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 11. Senat, Urteil vom 03.07.2015, 11 B 14.2809). (Olaf Dilling)
re|Adventskalender – Das 12. Türchen: Wie fest ist Klärschlamm?
Manchmal braucht es erstaunlich viel juristischen Aufwand, um eine naturwissenschaftliche Selbstverständlichkeit zu verteidigen. Zum Beispiel diese: Etwas, das aussieht wie Blumenerde, sich anfühlt wie Blumenerde und sich transportieren lässt wie Blumenerde, ist – Überraschung – kein Flüssigbrennstoff.

Genau darüber wurde mehrere Jahre gestritten. Streitgegenstand: die behördliche Auffassung, entwässerter kommunaler Klärschlamm sei „flüssig“. Begründung: Er könne gepumpt werden. Nun lässt sich vieles pumpen, wenn man nur genug Energie hineinsteckt. Auch Beton. Oder Kartoffelbrei. Die Physik zeigt sich davon wenig beeindruckt – und das Verwaltungsrecht eigentlich auch nicht.
Pumpfähig ≠ flüssig
Die zuständige Behörde hielt dennoch lange an der These fest, die Pumpfähigkeit sei das entscheidende Abgrenzungskriterium zwischen fest und flüssig. Ein Konzept, das weder im Gesetzestext noch in den einschlägigen europäischen Vorgaben wirklich vorkommt, sich aber hartnäckig hielt.
Demgegenüber stand eine eher altmodische Auffassung: Fest ist, was physikalisch fest ist.
Stichfest. Krümelig. Transportiert im Kipp-LKW und nicht im Tankwagen. Das wurde belegt: Mit Fotos, Gutachten, Verweisen auf Technikrecht, Umweltrecht und sogar die Düngeverordnung (die bekanntlich ein recht bodenständiges Verhältnis zu Stoffzuständen hat).
Klage erheben – Erkenntnis fördern
Nachdem all das im Verwaltungsverfahren nicht zur gewünschten Einsicht führte, wurde Klage erhoben. Und siehe da: Im Jahr 2025 erkannte die Behörde schließlich an, dass entwässerter Klärschlamm fest ist. Die Physik dürfte erleichtert gewesen sein. Eine Gerichtsentscheidung war nicht mehr nötig – die Erkenntnis setzte sich auch ohne Urteil durch. Wir konnten also die Erledigung erklären.
Und warum das alles? Vom Aggregatzustand des entwässerten Klärschlamms hängt es ab, wie aufwändig die Berichterstattung über diesen Brennstoff im Emissionshandel ausfällt und welche Kosten dem Verwerter entstehen (Miriam Vollmer).
re|Adventskalender – Das 11. Türchen: Abfallrecht 2025 – Ein poetischer Blick mit Nebenbestimmungen
Im Jahr’ zwei-null-zwo-fünf, ich sag‘s euch gleich,
wenn das Recht nicht müde wird – nur umfangreich:
Die Circular Economy schwebt wie ein Engel im Raum,
begrifflich zwar politisch, doch juristisch ein Traum.
Die Kreislaufwirtschaft ist nun Staatsraison,
linear ist verpönt – wir brauchen Substitution!
Mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie als Plan
weiß jeder Jurist: Jetzt geht’s erst richtig an.
Produkte, Ökodesign, Lebenszyklusdenken,
alles schön normativ – doch wer soll’s lenken?
Der Mandant fragt leise: „Was heißt das konkret?“
Der Anwalt antwortet ehrlich: „Es kommt drauf an – wie stets.“
Der Entsorgungsfachbetrieb zeigt Zertifikat und Konzept,
doch das Amt fragt weiter: „Wird denn das auch gelebt?“
Dokumentation, Schulung, beim Nachweis beeilt–
wer hier lacht, hat die letzte Schulung verpeilt.
Und dann – Brände bei Entsorgern, landab und landauf,
Batterie im Restmüll, das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Die Behörde reagiert reflexartig schnell:
„Mehr Brandschutz! Mehr Versicherung!“ Ganz generell!
Die Ersatzbaustoffverordnung tritt streng und bestimmt,
Doch bleibt es beim Abfall, wann man sie nimmt?
Mineralisch? Geeignet? Einbauweise ist klar?
Sonst winkt die Behörde – mit Rückbaugefahr.
Und überall Genehmigungen, gestaffelt und stramm,
BImSchG, KrWG usw. – das volle Programm.
Änderungsanzeige oder Neugenehmigungspflicht?
Die Antwort lautet meist: „Kommt drauf an – aus anwaltlicher Sicht.“
Denn im Genehmigungsrecht wird’s richtig poetisch:
Antrag vollständig, Prognose hypothetisch.
Emissionen, Immissionen, Stand der Technik bedacht,
mit Ingenieur (und etwas Anwalt): Bescheid „Nr. 8“ – über Nacht.
Ah, die Sicherheitsleistung, so beliebt wie bekannt,
sie sichert die Nachsorge – theoretisch elegant.
Wie hoch? Warum? Mit welcher Berechnung genau?
Das klärt man im Widerspruch – oder vor Gericht, schlau.
So dreht sich der Kreislauf aus Recht und Papier,
zwischen Anspruch, Wirklichkeit und Vollzugsturnier.
Doch eines bleibt sicher im Abfall-Revier:
Mit Humor geht es besser – wir schwör’n es Dir.
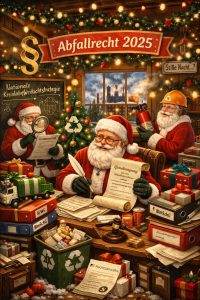
(Dirk Buchsteiner)
re|Adventskalender – Das 10. Türchen: Manchmal muss es schnell gehen

Versorgungsunterbrechungen sind immer eine unangenehme Angelegenheit. Und manchmal muss es sehr schnell gehen – besonders wenn man eine solche Sperrung verhindern will.
In dieser Situation waren wir im August diesen Jahres. Unser Mandant war eine große Berliner Wohnungseigentümergemeinschaft und lag im Streit mit der Danpower Energie Service GmbH. Diese vertrat die Rechtsauffassung, dass der bis dato bestehende Wärmelieferungsvertrag unserer Mandantin von ihr ordentlich gekündigt worden sei – während unsere Mandantin von einer Fortgeltung des Vertrages aufgrund bestehender Vertragsbindung ausging. Zu Recht, wie auch wir meinten.
Alle Versuche die Situation im Vorfeld gütlich zu regeln oder zumindest eine Übergangslösung zu finden, welche die Wärmeversorgung der Anwohner bis zur Klärung der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Kündigung sichergestellt hätte, scheiterten und unsere Mandantin musste davon ausgehen, dass eine Unterbrechung der Wärmeversorgung unmittelbar bevorstand.
Wir wussten was in dieser Situation zu tun ist und beantragten beim Landgericht Potsdam im Rahmen eines Eilverfahrens den Erlass einer einstweiligen Verfügung mit der Verpflichtung die Wärmeversorgung aufrechtzuerhalten. Und waren damit erfolgreich. Die Wärmeversorgung unserer Mandantin besteht seither fort, ein Hauptsacheverfahren ist anhängig.
(Christian Dümke)
re|Adventskalender – Das 9. Türchen: „Ihr Kinderlein kommet…“ zu Fuß zur Schule heut‘ all‘
Mit den Schulstraßen hatten wir uns letztes Jahr schon in einem Gutachten beschäftigt. Aber wie es so ist: Nachdem 2024 die StVO reformiert worden war und dieses Jahr die Verwaltungsvorschriften, gab es viele Fragen, die bei der Umsetzung vor Ort neu beantwortet mussten.

Aber kurz noch mal zurück, was sind eigentlich Schulstraßen? Immer mehr Eltern, Kinder und Nachbarn von Schulen klagen über sogenannte „Elterntaxis“, die zu Schulbeginn und ‑ende die Straßen blockieren und unter Zeitdruck Schulkinder oder Dritte gefährden. Bei den unübersichtlichen Situationen kann leicht ein kleines Kind zwischen großen, rangierenden Fahrzeugen übersehen werden. Daher haben viele Gemeinden Initativen gestartet, Schulstraßen oder Straßenabschnitte vom Kfz-Verkehr freizuhalten und zumindest zu bestimmten Tages- und Wochenzeiten ganz dem nicht-motorisierten Verkehr zur Verfügung zu stellen.
Rechtlich war das bisher schwierig. Entweder es musste eine qualifizierte Gefahrenlage begründet werden, was aus Sicht vieler Behörden z.B. eine starke Häufung von Unfällen voraussetzt, oder es war ein relativ umständliches Verfahren der Teileinziehung der Straße erforderlich. Durch die Reform des Straßenverkehrsrechts gibt es neben weiteren Änderungen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit jedoch die Möglichkeit, angemessene Flächen für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung zu stellen. Dies erfordert nicht mehr eine konkrete Gefahr für Sicherheit und Ordnung des Verkehrs. Vielmehr lässt sich die Umverteilung der Flächen auch mit Umwelt‑, insb. Klimaschutz, Gesundheitsgründen rechtfertigen. Weiterhin kann auch die Förderung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung als Grund für die Umnutzung des Straßenraums dienen.
Diese neue Möglichkeit bietet sich besonders für temporäre Anordnungen an, die den Verkehr zu Schulbeginn und ‑ende regeln. Einen Überblick über die rechtlichen Voraussetzungen und weitere Hinweise geben wir in einem aktualisierten Rechtsgutachten, das wir für Kidical Mass Aktionsbündnis, den VCD, das deutsche Kinderhilfswerk und Changing Cities erstellt haben, und dem dazugehörigen Leitfaden. Übrigens freuen wir uns, dass der Leitfaden wieder große Resonanz gefunden hat und in das Wissenspool des Bundesamts für Logistik und Mobilität aufgenommen wurde. Im Übrigen übernehmen auch mehr und mehr Bundesländer unsere Argumente, so etwa in einem Erlass von diesem Sommer, kurz nach Erscheinen unseres Updates, aus Baden-Württemberg. (Olaf Dilling)
re|Adventskalender – Das 8. Türchen: Strom vom Dach
Kohle und Klärschlamm, Wind und Freifläche, Biogas und Erdgas – auch in diesem Jahr hatten wir praktisch alle stromerzeugenden Anlagen auf dem Tisch. Und auch 2025 waren wieder zahlreiche Projekte dabei, die auf Dächern errichtet werden. Standard jeweils: Den Löwenanteil des erzeugten Stroms wird im Gebäude selbst verbraucht, der Rest wird über einen Direktvermarkter in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist.
Bei allen oberflächlichen Ähnlichkeiten ging am Ende jedoch kein Vertrag zweimal aus dem Haus. Natürlich verfügen wir – wie alle in diesem Bereich erfahrenen Akteure – über einiges in der (elektronischen) Schublade. Doch keine Konstellation und keine Interessenlage gleicht der anderen vollständig. In einem Gebäude möchte ein Mieter das bislang nicht mitvermietete Dach künftig nutzen und den Strom selbst verbrauchen. In einem anderen wird ein dem Eigentümer verbundenes Unternehmen aktiv und verkauft den Strom. Bisweilen betreibt ein Unternehmen sowohl eine PV-Anlage auf einem fremden Dach als auch eine Wärmeerzeugungsanlage im Keller. Und auch die Vermarktung von Überschüssen zeigt sich bei näherer Betrachtung durchaus unterschiedlich.
Wenn wir nicht einen fremden Vertrag zur Prüfung vorgelegt bekommen, entwickeln wir nach der Besprechung der Konstellation und der Interessenlage den Vertrag gemeinsam mit dem Mandanten – häufig in mehreren Runden mit den Vertragspartnern. Bisweilen geht das sehr schnell. Manchmal, gerade wenn es nicht nur um die Aufdach-PV geht, bleibt die Akte lange bei uns offen. Und manchmal fahren wir an Malls, Wohngebäuden, Hotels oder Logistikhallen vorbei und freuen uns ein wenig, wenn die Module in der Sonne glitzern.
Aber wissen Sie, was wir auch 2025 rein gar nicht gesehen haben? Mieterstrommodelle und die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Wir haben beide Modelle oft mit Mandanten besprochen. Doch zumindest bei uns spielen sie weiterhin die Rolle des Yeti im Himalaya: Andere, tapfere Juristen mögen ihn irgendwo in den weißen Wänden des Hochgebirges gesichtet haben. Wir aber, hier unten in den Niederungen rund um den Hackeschen Markt, haben auch dieses Jahr oft über den Yeti gesprochen – verkauft haben wir ihn nicht (Miriam Vollmer).