Wie der Wind sich hebt: Klage gegen Windpark Hohfleck erfolgreich
Die Genehmigung für Windenergieanlagen ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Es gibt viele (vielleicht sogar zu viele) Belange, die man zwingend beachten muss und die dann auch rechtlich relevant werden können. Gegen die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen für den Windpark Hohfleck/Sonnenbühl war zuletzt ein Umweltverband teilweise am 11.12.2023 vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erfolgreich. Seit dem 13.03.2024 liegen die Urteilsgründe vor. Wieder einmal ging es u.a. um den Rotmilan.
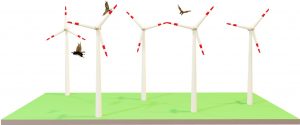
Noch vor dem VG Sigmaringen war es 2019 hinsichtlich dieses Vorhabens um die denkmalschutzrechtlichen Belange des nahegelegenen Schlosses Lichtenstein gegangen. Diese standen dem Vorhaben nicht entgegen. Vor dem VGH ging es um die pauschale Abschaltung während der Brutzeit durch ein automatisches Abschaltsystem und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von 2022. Schutzmaßnahmen gibt es zwar. Insbesondere verbietet die Genehmigung den Betrieb der Windkraftanlagen in der Brutzeit des Rotmilans vom 1. März bis zum 15. September eines Jahres zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zudem sieht die Genehmigung jedoch vor, dass zukünftig ein bis dahin in Deutschland allgemein auch für Waldstandorte eingeführtes und verifiziertes Abschaltsystem, das den Anforderungen der dann geltenden Rechtslage entspricht, unter bestimmten Voraussetzungen in Abstimmung und mit schriftlicher Zustimmung der Genehmigungsbehörde installiert werden könne. Hiergegen war der Umweltverband erfolgreich.
Die Genehmigungsbehörde habe hinsichtlich der betroffenen Greifvogelarten Rot- und Schwarzmilan zwar zu Recht angenommen, dass das Tötungsrisiko mit den angeordneten Abschaltzeiten (1. März bis 15. September zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang) unter die Signifikanzschwelle gesenkt wird. Rechtswidrig sei hingegen die Regelung zur Möglichkeit der zukünftigen Installation eines bis dahin in Deutschland allgemein auch für Waldstandorte eingeführten und verifizierten Abschaltsystems anstelle der pauschalen Abschaltung.
Diese Regelung sei im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Genehmigung nicht genehmigungsfähig gewesen, entschied der VGH. Ohne Abschaltkonzept und dessen Validierung lasse sich nicht feststellen, ob ein solches System geeignet sei, um anstelle der grundsätzlich zulässigen Pauschalabschaltung das Tötungsrisiko für den Rot- und Schwarzmilan unter die Signifikanzschwelle zu senken, so die Mannheimer Richter. Die Verlagerung dieser Prüfung in ein nachgelagertes Abstimmungs- und Zustimmungsverfahren sei nicht zulässig. Indem die eigentliche Eignungsprüfung des Abschaltsystems aus dem Genehmigungsverfahren in ein nachgelagertes Verfahren ausgegliedert und die Installation nur von der Zustimmung der Genehmigungsbehörde abhängig gemacht werde, würden die Regelungen über die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Kontrollmöglichkeiten durch Umweltvereinigungen unzulässig beschnitten. Dieses Vorgehen widerspreche dem Regelungsregime des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (vgl. §§ 15, 16 und 16a BImSchG). (Dirk Buchsteiner)

 Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes sind die damit verfolgten Gemeinwohlziele des Klimaschutzes, des Schutzes von Grundrechten vor Beeinträchtigungen durch den Klimawandel und der Sicherung der Stromversorgung hinreichend gewichtig, um den mit der Beteiligungspflicht verbundenen Eingriff in die Berufsfreiheit der Vorhabenträger aus Art. 12 Abs. 1
Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes sind die damit verfolgten Gemeinwohlziele des Klimaschutzes, des Schutzes von Grundrechten vor Beeinträchtigungen durch den Klimawandel und der Sicherung der Stromversorgung hinreichend gewichtig, um den mit der Beteiligungspflicht verbundenen Eingriff in die Berufsfreiheit der Vorhabenträger aus Art. 12 Abs. 1