Kein Bestandsschutz für zerstörten Campingplatz an der Ahr
Vermutlich ist dem Verwaltungsgericht (VG) Koblenz die Entscheidung nicht leicht gefallen: Ein Inhaber eines Campingplatzes an der Ahr wurde die Anlage in der Hochwasserkatastrophe 2021 zerstört. Zerstört ist jetzt auch die Aussicht auf den Wiederaufbau. Denn das VG hat der Baubehörde recht gegeben, die den Wiederaufbau des Campingplatzes nicht zulässt.
An sich wäre eine Campinganlage nach der typischen Definition der Bauordnungen der Länder auch keine – jedenfalls keine einheitliche – bauliche Anlage im baurechtlichen Sinne. Denn bauliche Anlagen sind demnach mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen, so auch § 2 Abs. 1 Satz 1 LBauO RP. Allerdings gibt es nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 LBauO RP eine gesetzliche Fiktion, nach der auch Campingplätze bauliche Anlagen sind.
Dies war zum Zeitpunkt der Errichtung des Campingplatzes an der Ahr noch nicht der Fall. Denn aus dieser Zeit gibt es keine Baugenehmigung für die gesamte Anlage, sondern nur für zwei Funktionsgebäude. Für den Campingplatz insgesamt gibt es nur eine gewerberechtliche Zulassung aus dem Jahr 1969. Dass der Campingplatz bis unmittelbar vor der Katastrophe zulässig war, lag insofern am Bestandsschutz. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts besagt nämlich, dass eine Anlage, die in der Vergangenheit dem Baurecht entsprach, aufgrund der Eigentumsfreiheit in ihrem Bestand geschützt ist. Nachträglich geänderte Anforderungen wie das Erfordernis einer Baugenehmigung spielen insofern keine Rolle.
Voraussetzung für diesen Bestand ist jedoch der Fortbestand der Anlage. Im Fall des Campingplatzes war die Infrastruktur der Anlage durch das Wasser und Sedimente vollkommen zerstört worden. Auch von den beiden genehmigten Gebäuden standen nur noch die Mauern. Daher konnte, wie das VG Koblenz beschlossen hat, der Eigentümer sich nicht mehr auf den Bestandschutz berufen. Was für den Kläger eine individuelle Härte darstellt, ist allerdings vor dem Hintergrund öffentlicher Belange nachvollziehbar. Bei einer Neuerrichtung sollte zumindest geprüft werden, ob die Anlage angesichts des Risikos einer weiteren Flut unter baurechtlichen Gesichtspunkten sicher zu errichten ist. (Olaf Dilling)
 Dann, aber auch nur dann, darf der Eigentümer auf das Wärmenetz mit seiner konventionell betriebenen Heizung warten. Steht das Netz, muss er sich aber auch anschließen. Darauf zu beharren, seine Gas- oder Ölheizung gefalle ihm eigentlich besser und sei ja auch noch gar nicht so alt, kann er dann nicht.
Dann, aber auch nur dann, darf der Eigentümer auf das Wärmenetz mit seiner konventionell betriebenen Heizung warten. Steht das Netz, muss er sich aber auch anschließen. Darauf zu beharren, seine Gas- oder Ölheizung gefalle ihm eigentlich besser und sei ja auch noch gar nicht so alt, kann er dann nicht.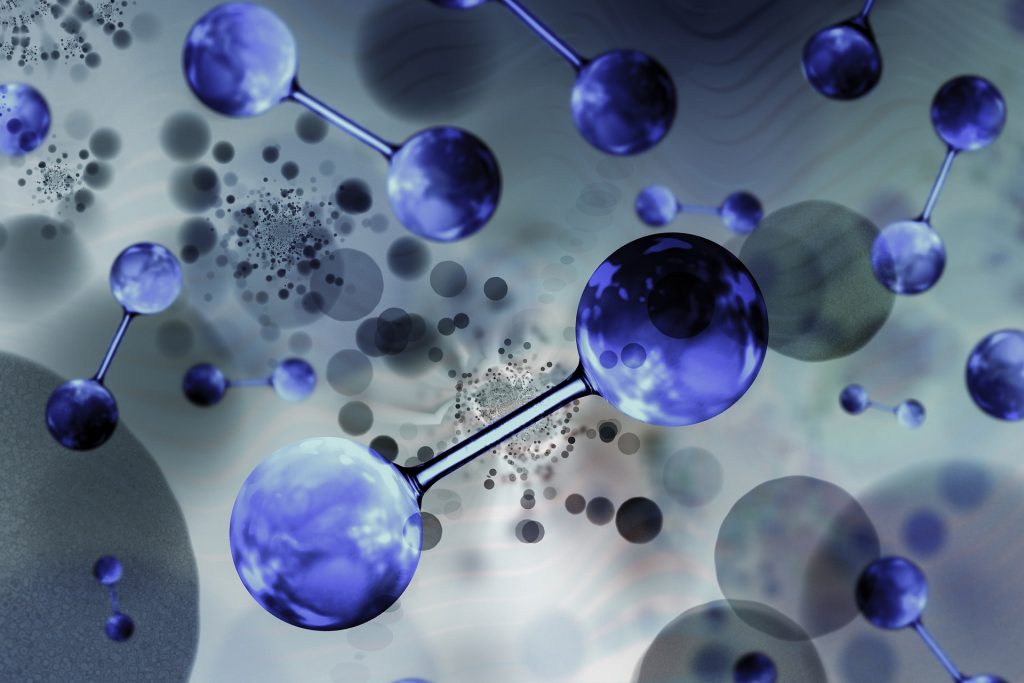 Auch ist es nicht möglich, überall diesen Weg zu gehen, sondern nur in per Wärmeplanung und landeshördlichem Beschluss ausgewiesenen Wasserstoffnetzausbaugebieten, in denen spätestens Ende 2044 100% Wasserstoff fließen sollen. Zudem muss der Gasnetzbetreiber mit der im jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle einen Fahrplan für die Umstellung der Netzinfrastruktur vorgelegt haben, der die technischen und zeitlichen Schritte für die Umstellung vorsieht, darlegt, wo der Wasserstoff eigentlich herkommen soll, und wie das Ganze finanziert werden soll. Eine Darlegung, wie der Plan in die Klimaschutzziele des Bundes passt, und zwei- bis dreijährliche Meilensteine, gehören auch dazu.
Auch ist es nicht möglich, überall diesen Weg zu gehen, sondern nur in per Wärmeplanung und landeshördlichem Beschluss ausgewiesenen Wasserstoffnetzausbaugebieten, in denen spätestens Ende 2044 100% Wasserstoff fließen sollen. Zudem muss der Gasnetzbetreiber mit der im jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle einen Fahrplan für die Umstellung der Netzinfrastruktur vorgelegt haben, der die technischen und zeitlichen Schritte für die Umstellung vorsieht, darlegt, wo der Wasserstoff eigentlich herkommen soll, und wie das Ganze finanziert werden soll. Eine Darlegung, wie der Plan in die Klimaschutzziele des Bundes passt, und zwei- bis dreijährliche Meilensteine, gehören auch dazu.