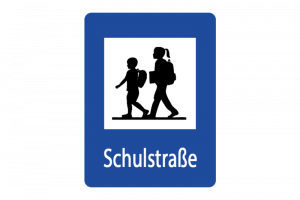BGH entscheidet zur Gestaltung des „Marktelementes“ in Wärmepreisklauseln
Die Preisgestaltung in Fernwärmelieferverträgen im Sinne der AVBFernwärmeV ist immer wieder Gegenstand rechtlicher und gerichtlicher Auseinandersetzung. § 24 AVBFernwärmeV verlangt für die Gestaltung von Preisanpassungsklauseln durch den Wärmelieferanten die Verwendung eines sogenannten Kostenelementes, dass die Kostenentwicklung des zur Wärmeerzeugung eingesetzten Brennstoffes widerspiegelt und zusätzlich ein Marktelement, dass die allgemeine Preisentwicklung auf dem Wärmemarkt widerspiegelt. Kostenelement und Marktelement sind dabei von gleicher Bedeutung, sollten also mit gleicher Gewichtung in die Preisbestimmung eingehen. Fehlt eines dieser beiden Elemente ist die Klausel unwirksam.
Dabei war in der Vergangenheit nie eindeutig geklärt, wie genau das Marktelement denn aussehen muss. Der BGH hatte lediglich entschieden, dass der darin zu berücksichtigende Wärmemarkt sich dabei auf andere Energieträger, als den tatsächlich im Rahmen des Kostenelementes eingesetzten Brennstoff erstreckt (BGH, 13.07.2011, VIII ZR 339/10; BGH, 01.06.2022, VIII ZR 287/20). Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich die Gestaltung der Fernwärmepreise „nicht losgelöst von den Preisverhältnissen am Wärmemarkt vollziehen kann“ (BR-Drucks. 90/80, S. 56 [zu § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV aF]).

Nun jedoch hat der BGH in einer aktuellen Entscheidung vom 27.09.2023, Az. VIII ZR 263/22 festgestellt, dass eine Preisklausel, die auf den Wärmepreisindex des Statistischen Bundesamtes Bezug nimmt das gesetzlich geforderte Marktelement in ausreichendem Maße abbildet. Für viele Fernwärmeversorger herrscht damit ein wenig mehr Rechtsklarheit, was die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen angeht. In der Vergangenheit waren öfter Preisklauseln durch Gericht für unwirksam erklärt worden, weil das Marktelement fehlte.
(Christian Dümke)