Urheberrecht an amtlich referenzierten „privaten“ Regelwerken
Unser Blog-Post über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) , dass technische Produktnormen Teil des Europarechts seien und daher kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten, hat einige Nachfragen und Zuschriften provoziert. Denn tatsächlich können viele Menschen nicht verstehen, dass für die Praxis so wichtige Vorschriften nicht frei zugänglich sind.
Nun, wir hatten ja schon gesagt, dass deutsche technische Normwerke nur national Wirkung entfalten und kein EU-Recht sind. Daher sind sie von der Entscheidung des EuGH nicht betroffen.
Nun beantwortet das noch nicht die Frage, wie es eigentlich nach deutschem Recht ist. Das ist eine Frage des Urheberrechts. Grundsätzlich sind Rechtstexte, seien es Gesetze, Verordnungen oder Gerichtsentscheidungen nicht durch das Urheberrecht geschützt. Das ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG).
Das gilt auch für „andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht“ werden. Daher sind inzwischen eigentlich alle Amtsblätter öffentlich kostenfrei im Internet zugänglich. Eine Ausnahme macht das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit seinem Amtsblatt. Aus uns nicht ganz erfindlichen Gründen ist es nicht kostenlos abrufbar. Sondern es ist im digitalen Jahresabonnement mit einer Einzellizenz zum Preis von schlappen 77,50 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich. Die Wege der Verkehrsverwaltung sind manchmal unergründlich.
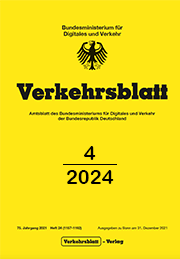
Anders ist es allerdings bei den technischen Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Hier gibt es die Ausnahme des § 5 Abs. 3 UrhG. Demnach ist auch dann ein Urheberrecht an technischen Regelwerken möglich, wenn offiziell in Gesetzen oder Verordnungen oder anderen amtlichen Rechtstexten auf sie verwiesen wird. Ob sie urheberrechtlich geschützt sind, richtet sich demnach nach dem Zivilrecht. Insbesondere muss Schöpfungshöhe gegeben sein, was bei technischen Texten nicht immer der Fall ist.
Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 f. UrhG hat der Inhaber des Urheberrechts jedem Verlag der dies wünscht, unter angemessenen Bedingungen das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung einzuräumen. Ob diese Regelung, die offensichtlich auf käufliche Printprodukte abstellt, wirklich in die Welt frei zugänglicher Online-Ressourcen passt, mag dahingestellt sein. Um den Bürgern als Rechtsadressaten freien Zugang zu verkehrsrechtlich relevanten Texten zu geben, wäre es vermutlich an der Zeit, dass der Gesetzgeber diese urheberrechtlichen Regelungen über technische Regelwerke überdenkt. (Olaf Dilling)
