EuGH zur Frage der „privaten“ Normen
Mit dem Satz „Unsere Gesetze sind nicht allgemein bekannt, sie sind Geheimnis der kleinen Adelsgruppe, welche uns beherrscht“ beginnt eine skurrile Parabel von Kafka namens „Zur Frage der Gesetze“. So ganz ohne Realitätsbezug ist diese fiktive Erzählung nicht. Denn die heutige technisierte Welt oft weniger durch frei zugängliche Parlamentsgesetze beherrscht als durch technische Normen. Und diese sind bisher urheberrechtlich geschützt, so dass der Zugang zu ihnen beschränkt ist.
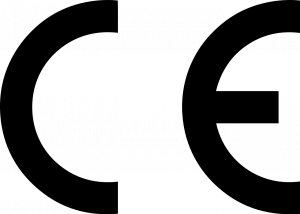
Technische Normen werden in kleinen, der Öffentlichkeit typischerweise unzugänglichen Expertenrunden erstellt. Berühmt ist die Internationale Standardisierungsorganisation (ISO). Im Verkehrsbereich entspricht dem in Deutschland die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV). Und deren Produkte, die technischen Normen, sind mitnichten frei zugänglich. Sie haben ihren Preis und der ist hoch genug, um durchschnittliche Privatleute faktisch vom Zugang auszuschließen. Denn wer wissen will, ob der neue Radweg zur Schule seiner Kinder nach den Regeln der Ingenieurskunst geplant wurde, sollte in die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) schauen. Und die kosten – egal, ob gedruckt oder elektronisch - immerhin 64,80 Euro. Das ist vielleicht nicht die Welt, aber für Leute, die nur mal einen Blick riskieren wollen, dennoch zu teuer.
Bezüglich harmonisierter technischer Normen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Grundsatzentscheidung ein Recht auf freien Zugang eingeräumt. Denn diese seien Teil des EU-Rechts und Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des freien Zugangs zum Recht geböten dies. Für die FGSV oder das Deutsche Institut für Normung (DIN) gilt diese Rechtsprechung nicht. Denn der EuGH kann ja nur für Europäisches Recht sprechen. Die Argumente des EuGH ließen sich aber auf das deutsche Recht übertragen. Dafür müsste aber anerkannt werden, dass es sich bei technischen und planerischen Normen um Recht handelt, da sie oft entscheidend sind für die konkrete Verwirklichung und Ausgestaltung von Grundrechten. (Olaf Dilling)

