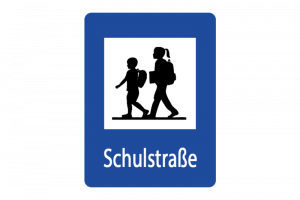VGH BW: Schulwegsicherheit auch präventiv möglich
Es ist ein Skandal des deutschen Verkehrsrechts, dass erst Unfälle nachgewiesen werden müssen, bevor Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ergriffen werden können. So jedenfalls ein in deutschen Amtsstuben weit verbreiteter Mythos. Tatsächlich verlangen viele Straßenverkehrsbehörden und manche Gerichte beispielsweise für die Anordnung von Tempo 30 den Nachweis eines bereits bestehenden Unfallschwerpunkts. Gerade wenn es um die Sicherheit von Schulkinder geht, sorgt dies für Unverständnis. Denn wieso sollte man erst warten, bis buchstäblich Blut geflossen ist, wenn Unfälle vorhersehbar sind?
Die Orientierung an der Unfallstatistik lässt sich auch weder einem Gesetz bzw. einer Verordnung entnehmen, noch entspricht sie der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Vielmehr hat das BVerwG immer wieder entschieden, dass eine Prognose, aus der sich eine konkrete Gefahr ableiten lässt, ausreichend ist (z.B. BVerwG, Urteil vom 23.09.2010 – BVerwG 3 C 37.09, Rn. 31).

Ein Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg von Ende März diesen Jahres unterstützt dies noch mal am Beispiel von Gefahren auf einem Schulweg. Das Gericht hat es für ausreichend angesehen, dass eine Straßenquerung unübersichtlich, schlecht einsehbar und das allgemeine Geschwindigkeitsniveau hoch ist, um eine qualifizierte Gefahrenlage zu begründen. Damit ist die Voraussetzung für die Anordnung von Tempo 30 gegeben.
In dem Fall hatte jemand gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem Teilstück einer Kreisstraße geklagt. Die Klage war bereits vor dem Verwaltungsgericht Freiburg abgewiesen worden. Zu Recht, wie der Verwaltungsgerichtshof befunden hat. Was die Gefahrenprognose angeht, sei in der konkreten Situation eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit vermehrter Schadensfälle dann nicht erforderlich, wenn es um hochrangige Rechtsgüter wie Leib, Leben und bedeutende Sachwerte geht. Ein behördliches Einschreiten sei auch nach den Maßstäben des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO bereits bei einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zulässig und geboten.
Allerdings gibt die Entscheidung den Behörden keineswegs einen pauschalen Freibrief, verkehrsbeschränkende Maßnahmen überall dort anzuordnen, wo ein Schulweg die Straße quert. Vielmehr muss die konkrete Gefahr immer anhand der örtlichen Gegebenheiten begründet werden, z.B. Ausbau und Funktionsfähigkeit der Fußverkehrsinfrastruktur einschließlich vorhandener sicherer Querungsmöglichkeiten, Einsehbarkeit und Übersichtlichkeit des Straßenverlaufs und typischerweise gefahrener Geschwindigkeiten. Eine genaue Prüfung durch Juristen ist daher weiterhin sinnvoll, um die Voraussetzungen einer Anordnungen zu klären.
Trotzdem könnte die Entscheidung zu einem Umdenken im Bereich der Straßenverkehrsverwaltung beitragen. Selbst an Straßen, an denen ein Zugang der Schule vorhanden ist und daher die Ausnahme des § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 6 StVO greifen könnte, weigern sich Straßenverkehrsbehörden aktuell in manchen Fällen standhaft, zugunsten der Schulwegsicherheit Tempo 30 anzuordnen. Die Entscheidung des VGH Baden-Württemberg zeigt, dass ein Tempolimit sogar dann angezeigt sein kann, wenn ein Straßenabschnitt nicht direkt an der Schule liegt, aber häufig als Schulwegstrecke frequentiert wird. (Olaf Dilling)