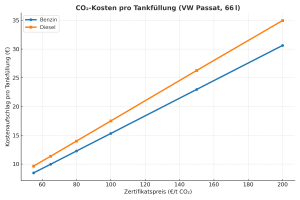BVerwG zum Klimaschutz beim Autobahnbau
Bei der Planung von Verkehrwegen wie Autobahnen muss der Klimaschutz berücksichtigt werden. Das ergibt sich aus dem Berücksichtigungsgebot des § 13 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). Nun könnten Spötter behaupten, dass der Bau von Autobahnen immer klimaschädlich sei, jedenfalls solange die Kraftfahrzeuge mit fossilen Brennstoffen getankt werden.
Dennoch gibt es beim Bau von Autobahnen deutliche Unterschiede. Dies liegt vor allem an der Bodenbeschaffenheit: Es gibt in Deutschland kohlenstoffhaltige Böden, die CO2 dauerhaft binden können, sogenannte Torf- oder Moorböden. Allerdings verlieren sie diese Eigenschaft, wenn abgetorft wird oder wenn der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. Denn dann wird der Kohlenstoff durch Mikroorganismen zersetzt, so dass CO2 freigesetzt und der Boden mineralisiert. Typischerweise ist dies beim Bau von Straßen und insbesondere Autobahnen der Fall, zum einen, weil der Torfboden ausgekoffert werden muss, zum anderen weil die Drainage und der Eingriff in tiefere Bodenschichten den Wasserhaushalt irreversibel verändert.

Rübker Moor bei Buxtehude nahe dem geplanten A26-Abschnitt (Foto: Aeroid, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)
In Norddeutschland stellt sich dieses Problem bei der Erweiterung der Küstenautobahn A26 im Nordwesten zwischen Bremerhaven und Hamburg. Zwei Umweltverbände hatten dort gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt. Inzwischen wurde diese Klage vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Es hat der Klage zum Teil stattgegeben (BVerwG 9 A 2.24 – Urteil vom 08. Oktober 2025). Der Autobahnbau wird dadurch nicht verhindert. Das fordert das Klimaschutzgesetz auch nicht. Allerdings hätte der Träger eine alternative Trasse prüfen sollen, die nicht in Moorböden eingreift und daher vermutlich weniger starke negative Auswirkungen auf das Klima hat. Sie ist auch unter Biodiversitätsgesichtspunkten vorteilhafter, kürzer und daher vermutlich kostengünstiger.
Die Entscheidung zeigt, dass umweltrechtliche Gesichtspunkte, insbesondere Belange des Klima‑, Naturschutz- und Wasserrechts bei der Planung und dem Bau von Straßen immer wichtiger werden und von den Träger der Straßenbaulast oft unterschätzt werden. Am Ende kann die Planung teuer und langwierig werden, wenn diese Aspekte am Anfang nicht ausreichend beachtet wurden (Olaf Dilling)