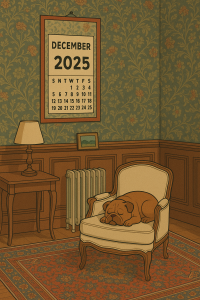re|Adventskalender: Wie weiter mit dem GEG?
Projekte, Prozesse, Verträge sind unser Alltag. Aber bisweilen beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wie es eigentlich um Gesetze und Gesetzesvorhaben steht. Im Auftrag des Bundesverband Wärmepumpe e. V. haben wir im September begutachtet, ob der Bundesgesetzgeber die Ankündigung im Koalitionsvertrag umsetzen kann, die Novelle des Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ampel, das sogenannte „Heizungsgesetz“, wieder abzuschaffen.

Die Paragraphen 71 ff. des GEG schreiben seit 2023 bekanntlich vor, dass beim Heizungswechsel mindestens 65 % der erzeugten Wärme aus erneuerbaren Energien stammen müssen. Auf welche Art und Weise die Eigentümer dies bewerkstelligen, stellt das Gesetz in ihr Ermessen, wobei für eine Reihe von Technologien Nachweiserleichterungen gelten. Wärmepumpe, Solarthermie, Fernwärme und einige andere Optionen gelten unter definierten Voraussetzungen stets als zulässig, ohne dass der Gebäudeeigentümer die 65 % erneuerbare Energien noch aufwändig nachweisen müsste. Das Gesetz sieht großzügige Übergangsregelungen vor und ist mit der kommunalen Wärmeplanung synchronisiert; zudem greift die Pflicht zur Umrüstung erst beim Tausch der Heizung, nicht solange diese intakt ist und läuft. Gleichwohl gehörte das Gesetz zu den umstrittensten neuen Regelungen der vergangenen Bundesregierung.
Im Wahlkampf spielte die Frage, ob der Gesetzgeber die ungeliebten neuen Regelungen überhaupt einfach wieder abschaffen darf, indes keine große Rolle. Offenbar nahmen es viele als selbstverständlich an, dass die Wiederherstellung eines früheren Rechtszustandes auch für die Zukunft nicht auf rechtliche Bedenken stoßen würde. Im Zuge unserer Prüfung kamen wir jedoch zu dem Ergebnis, dass dies in diesem konkreten Falle so nicht zutrifft.
Zum einen hat sich der rechtliche Rahmen verändert. In den letzten Jahren hat der europäische Gesetzgeber mit der Neufassung Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) die Anforderungen für die Nutzung erneuerbarer Energien auch im Gebäudebereich verschärft. Auch die novellierte Gebäuderichtlinie (EPBD) steht einer Rückkehr zum alten Gebäudeenergiegesetz entgegen. Doch nicht nur die europäischen Regelungen binden den deutschen Gesetzgeber. Auch Art. 20a des Grundgesetzes, der die natürlichen Lebensgrundlagen im Interesse künftiger Generationen schützt, sowie die Grundrechte, die nach dem bekannten Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 dem Gesetzgeber die Pflicht auferlegen, die bestehenden Emissionsspielräume nicht heute so auszureizen, dass kommenden Generationen keine Freiheiten mehr bleiben, enthalten ein Verschlechterungsverbot, das es dem Gesetzgeber verbietet, bestehende Regeln ersatzlos aufzuheben, ohne an anderer Stelle einen in der Sache gleichwertigen Ausgleich zu schaffen.
Im Ergebnis bedeutet das: Der Gesetzgeber könnte die Paragraphen 71 ff. GEG nur dann aufheben, wenn er die Minderung der Emissionen des Gebäudesektors durch ein anderes rechtliches Instrument in vergleichbarer Weise sichert. Will er das ungeliebte GEG ändern, muss der Gesetzgeber also einige Kreativität beweisen.Wir sind entsprechend gespannt, wie der Entwurf des neuen GEG aussieht, wenn das BMWE ihn vorlegt (Miriam Vollmer).