BGH kippt Erlösobergrenze der Gasnetzentgeltregulierung wegen fehlerhaftem Effizienzvergleich
Netznutzungsentgelte unterliegen in Deutschland der staatlichen Kontrolle, genauer gesagt der Kontrolle durch die Bundesnetzagentur. Diese legt jedoch nicht für jeden einzelnen Netzbetreiber das zulässige Entgelt in tatsächlicher Höhe vor, sondern legt für jede Regulierungsperiode im Rahmen der Anreizregulierung eine sog. Erlösobergrenze fest.
Wichtiger Bestandteil zur Festlegung dieser Erlösobergrenze ist nicht nur die beim jeweiligen Netzbetreiber vorliegende Kostenstruktur, die durch die Netznutzungsentgelte finanziert werden muss, sondern auch die jeweilige Effizienz des Unternehmens. Denn der Staat möchte die Netzbetreiber durch die Netzentgeltregulierung zu stetiger Effizienzsteigerung anhalten.
Zu diesem Zweck findet regelmäßig ein Effizienzvergleich der Netzbetreiber statt, den die Bundesnetzagentur vornimmt, um den jeweiligen Effizienzwert zu bestimmen.

Diese Bestimmung erfolgte jedoch fehlerhaft, stellte nun der Bundesgerichtshof mit Entscheidung vom 26.09.2023, Az. EnVR 37/21 fest. Die auf dieser Basis ermittelte Erlösobergrenze ist damit unwirksam und muss neu bestimmt werden. Der zentrale Fehler des Effizienzvergleiches ist nach Ansicht der klagenden Netzbetreiber und auch des BGH, dass auch Netzbetreiber mit einer abweichenden Versorgungsstruktur, die regionalen Fernleitungsversorger, einbezogen worden sind.
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf als Vorinstanz hatte die Rechtsfrage noch anders beurteilt. und das Vorgehen der Bundesnetzagentur unter Verweis auf das bestehende „Regulierungsermessen“ als zulässig erachtet.
Es ist nicht das erste Mal, dass Netzbetreiber erfolgreich gegen die Festlegung der Erlösobergrenze vorgehen.
(Christian Dümke)
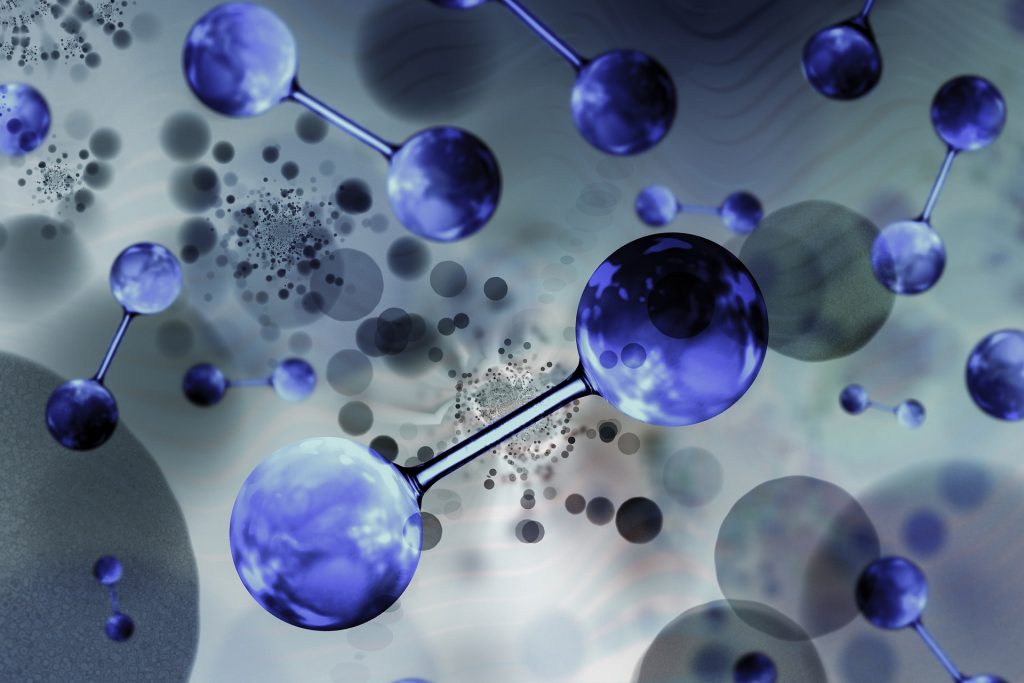 Auch ist es nicht möglich, überall diesen Weg zu gehen, sondern nur in per Wärmeplanung und landeshördlichem Beschluss ausgewiesenen Wasserstoffnetzausbaugebieten, in denen spätestens Ende 2044 100% Wasserstoff fließen sollen. Zudem muss der Gasnetzbetreiber mit der im jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle einen Fahrplan für die Umstellung der Netzinfrastruktur vorgelegt haben, der die technischen und zeitlichen Schritte für die Umstellung vorsieht, darlegt, wo der Wasserstoff eigentlich herkommen soll, und wie das Ganze finanziert werden soll. Eine Darlegung, wie der Plan in die Klimaschutzziele des Bundes passt, und zwei- bis dreijährliche Meilensteine, gehören auch dazu.
Auch ist es nicht möglich, überall diesen Weg zu gehen, sondern nur in per Wärmeplanung und landeshördlichem Beschluss ausgewiesenen Wasserstoffnetzausbaugebieten, in denen spätestens Ende 2044 100% Wasserstoff fließen sollen. Zudem muss der Gasnetzbetreiber mit der im jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle einen Fahrplan für die Umstellung der Netzinfrastruktur vorgelegt haben, der die technischen und zeitlichen Schritte für die Umstellung vorsieht, darlegt, wo der Wasserstoff eigentlich herkommen soll, und wie das Ganze finanziert werden soll. Eine Darlegung, wie der Plan in die Klimaschutzziele des Bundes passt, und zwei- bis dreijährliche Meilensteine, gehören auch dazu.