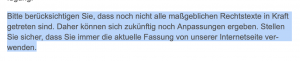Der Sprung: Vom BEHG zum ETS II
Ab 2027 werden auch die Emissionen aus Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl europaweit bewirtschaftet. Das neue System heißt ETS II. Ab diesem Jahr wird es damit einen europäischen Marktpreis für die aus der Verbrennung dieser Brenn- und Treibstoffe resultierenden Emissionen geben. Die Bundesrepublik hat dann keine Möglichkeit mehr, durch kosmetische Änderungen im Klimaschutzgesetz mangelnde Minderungserfolge in den Sektoren Gebäude und Verkehr zu verstecken: Der Verbraucher zahlt dann einen ehrlichen Preis an der Tankestelle oder auf der Gasrechnung, der auf dem auf jede t CO2 heruntergebrochenen Minderungsziel für diese Sektoren beruht. Bis es soweit ist, läuft der deutsche Brennstoff-Emissionshandel, der nach ganz ähnlichen Regelungen abläuft, wie sie für den ETS II gelten sollen, nur gibt es derzeit noch keine Marktpreis, sondern staatlich festgelegte Fixpreise ohne festgelegtes und damit endliches Budget.
Doch auch wenn der Sprung vom BEHG ins neue EU-System erst 2027 ansteht, so wird der ETS II hinter den Kulissen bereits ab dem laufenden Jahr vorbereitet. An sich hätte die Bundesrepublik bis zum 30.06.2024 die neuen Regeln umsetzen und so wichtige gesetzliche Gundlagen festlegen müssen. Denn auch wenn das offensichtlich nicht funktioniert hat, muss die Bundesrepublik bis Ende 2024 eine ergänzende Berichterstattung durch die Verantwortlichen für das neue System gewährleisten, die ab Berichtsjahr 2024 vorgesehen ist.

Doch wie soll der Übergang nun konkret aussehen? Bis jetzt gibt es keine Äußerungen hierzu aus der Bundesregierung. Interessant ist allerdings ein Papier der Agora, die ein Konzept für den Übergang vom nationalen zum EU-Emissionshandel schon im Oktober 2023 vorgelegt hat.
Interessant: Die Agora erwartet einen CO2-Preis im ETS II von über 200 EUR. Dies beruht auf dem schleppenden Emisisonsrückgang in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Tatsächlich passiert vor allem im Verkehrsbereich praktisch nichts. Auf dieser Basis überschlägt die Agora einen Preisanstieg für Benzin von 38 ct/l und von 3 ct/kWh für Erdgas.
Um einen krassen Preissprung zu vermeiden, schlägt der Think Tank vor, den nationalen CO2-Preis schneller als bisher festgelegt zu erhöhen, um so Marktsignale zu setzen und zu verhindern, dass Menschen 2027 durch den ETS II überrascht werden. Anders als viele Befürworter des Emissionshandels fordern, setzt sich die Agora nicht nur „ETS only“ ein, also eine rein marktgestützte Strategie, sondern für einen Instrumentenmix unter Einschluss von Ordnungsrecht. Zudem sollen die Einnahmen aus dem Emissionshandel genutzt werden, die Bürger zu entlasten und den Technologiewechsel zu erleichtern.
Es bleibt abwarten, wie die Bundesregierung diesen Übergang nun gestaltet. Bleibt sie untätig, so würde dieses und nächstes Jahr der Preis für fossile Brenn- und Treibstoffe sich nur sehr wenig verändern, um dann 2026 und erst recht 2027 steil nach oben zu gehen. Dies müsste dann aber die nächste Bundesregierung kommunizieren und moderieren (Miriam Vollmer).