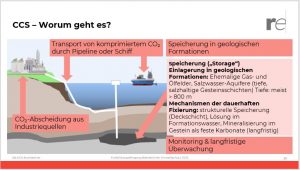Berliner Abfallrechtstage 2025
Die Kreislaufwirtschaft gehört zu den zentralen strategischen Zukunftsfeldern Europas. Angesichts steigender Rohstoffpreise, geopolitischer Abhängigkeiten und der klimapolitischen Notwendigkeit, Emissionen deutlich zu reduzieren, rückt die ressourcenschonende Gestaltung industrieller und kommunaler Stoffströme stärker denn je in den Fokus politischer Entscheidungen. Die Berliner Abfallrechtstage 2025 boten vor diesem Hintergrund einen umfassenden Einblick in die aktuellen politischen, rechtlichen und technologischen Entwicklungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft.
Unter der Tagungsleitung von Dr. Frank Petersen (Ministerialrat a.D., BMUKN) ging es um die Kreislaufwirtschaft in Krisenzeiten und aktuelle Herausforderungen mit der und durch die Rechtsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Im Rahmen der zweitägigen Tagung konnten führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Anwaltschaft zentrale Weichenstellungen für die kommenden Jahre diskutieren. Themen wie die Modernisierung des nationalen Abfallrechts, neue europäische Vorgaben (z.B. Novelle der Abfallrahmenrichtlinie, die PPWR, die Abfallverbringungsverordnung), der Circular Economy Act (CEA), der Clean Industrial Deals und die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) standen im im Fokus des Jahrestreffens der Abfallrechtlerfamilie.
Die diesjährige Veranstaltung stand ganz im Zeichen des glanzvollen 25-jährigen Jubiläums des Lexxion-Verlags. Seit seiner Gründung hat sich der Verlag zu einer der wichtigsten unabhängigen wissenschaftlichen Plattformen entwickelt. Zahlreiche Publikationen, Fachtagungen und insbesondere Fachzeitschriften aus dem Hause Lexxion haben maßgeblich dazu beigetragen, den wissenschaftlichen Diskurs auf europäischer Ebene zu fördern und sind wichtige Impulsgeber für rechtliche Entwicklungen.

Hinter dem Lexxion-Verlag stehen mit der Verlegerfamilie Andreae, allen voran Dr. Wolfgang Andreae und der „First Lady of Lexxion“ Micheline Andreae, Persönlichkeiten mit vollem Einsatz und Bekenntnis für Europa und die Wissenschaft. Im Rahmen einer festlichen Jubiläumsfeier mit Abendessen am Donnerstagabend würdigten daher langjährige Weggefährten die Bedeutung des Lexxion-Verlags und die Verlegerpersönlichkeit Wolfgang Andreae („a true gentleman an scholar“) in sehr persönlichen Grußworten. Es gab auch Ente, Wein und gute Musik.

Highlight des Abends war der von Professor Caroline Buts (Vrije Universiteit Brussel) gekonnt und tiefgehend moderierte politische Dialog über Europa mit Peter Altmeier (ehem. Bundesminister für Wirtschaft und Energie). Altmeier unterstrich die Bedeutung des europäischen Integrationsprozesses, den er insbesondere auf die deutsch-französische Freundschaft zurückführte. Zudem sprach er sich für eine letzte Erweiterungsrunde um die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens aus, um durch und mit der EU alte Gräben zu überwinden und den Frieden in Europa zu sichern. Zu der Tagung erscheint in Kürze ein Tagungsbericht – wohl noch in diesem Jahr in Heft 6 der AbfallR. (Dirk Buchsteiner)