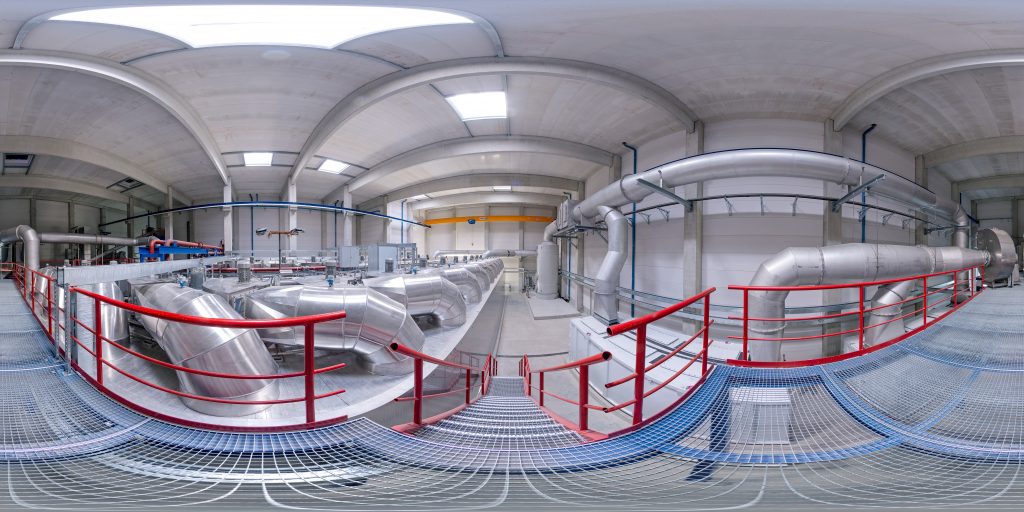VG Köln: E‑Roller als Sondernutzung
Das massenhafte gewerbliche Aufstellen von Fahrrädern oder kleinen und kleinsten Fahrzeugen der E‑Mobilität auf Gehwegen ist vielen ein Dorn im Auge. Gerade Menschen mit Sehbehinderungen und / oder Mobilitätseinschränkungen werden in ihrem Bewegungsradius stark durch wild abgestellte Fahrzeuge behindert. Über die Frage, ob das Aufstellen von gewerblichen Angeboten im Rahmen des Allgemeingebrauchs erlaubt ist oder eine straßenrechtliche Sondernutzung darstellt, gibt es schon länger einen Rechtsdisput, wobei mit „Call-a-Bike“ ein Fahrradverleih im Fokus stand.

Die Einstufung als straßenrechtliche Sondernutzung könnte im Umgang mit diesen neuen Formen geteilter Mobilität eine Art „Game-Changer“ sein. Denn mit der Genehmigungsbedürftigkeit hat der Staat, in diesem Fall Bundesländer oder Kommunen, es in der Hand, mit den gewerblichen Aufstellern Bedingungen auszuhandeln. Außerdem lässt sich der öffentliche Raum zur Nutzung für den ruhenden Verkehr dann zu einem gewissen Grad über die Erhebung von Sondernutzungsgebühren „kommerzialisieren“. Das gibt den Ländern auch finanzielle Ressourcen an die Hand, um weitere Infrastruktur, insbesondere spezielle Parkmöglichkeiten zu schaffen.
Nun hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln auch zu E‑Scootern eine Entscheidung gefällt: Der Rat der Stadt Köln hatte im Mai letzten Jahres die Satzung für Sondernutzung geändert. Dadurch waren Gebührentarife für Betreiber in Höhe von 85 bis 130 Euro pro Jahr und pro Fahrzeug möglich. Insgesamt konnten in Köln so Gebühren für das Abstellen von E‑Scootern in Höhe von 450.000 Euro generiert werden.
Das VG Köln hält diese Praxis in seiner Entscheidung für rechtmäßig: Damit gibt es einen legalen Hebel für die Regulierung des wilden Abstellens und die Finanzierung entsprechender Infrastruktur. Für (bisher von Scootern) behinderte Menschen und für die Kommunen ist dies eine gute Nachricht, da sich die ohnehin durch die Bundesebene aktuell stark eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten in der Verkehrspolitik erweitern. (Olaf Dilling)