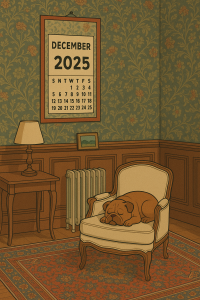Alpha Ventus – Pionier der deutschen Offshore-Windenergie
Der Windpark Alpha Ventus gilt als Meilenstein in der Geschichte der deutschen Energiewende. Er war der erste Offshore-Windpark Deutschlands und diente als technologische und wissenschaftliche Testplattform für die Nutzung von Windenergie auf hoher See. Mit seiner Inbetriebnahme begann ein neues Kapitel in der Entwicklung erneuerbarer Energien.
Alpha Ventus liegt rund 45 Kilometer nördlich der Insel Borkum in der Nordsee, auf dem sogenannten „Borkum-Cluster“. Der Standort befindet sich in einer Wassertiefe von etwa 30 Metern, was die Errichtung der Anlagen zu einer ingenieurtechnischen Herausforderung machte. Der Windpark besteht aus zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 60 Megawatt (MW). Errichtet wurden zwei unterschiedliche Anlagentypen: 6 Multibrid M5000-Anlagen (5 MW je Turbine) von Areva/REpower und 6 Adwen/AREVA-Anlagen von Senvion (ehemals REpower). Die Fundamente wurden als Tripod-Konstruktionen im Meeresboden verankert – eine damals neuartige Technik für Offshore-Projekte in dieser Tiefe.

Der Bau begann im Jahr 2008 unter Leitung der Projektgesellschaft Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG (DOTI), einem Konsortium der Energieunternehmen EWE, E.ON und Vattenfall. Die Bauphase war von schwierigen Wetterbedingungen und logistischen Herausforderungen geprägt. Trotzdem wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen – und diente anschließend als Blaupause für viele weitere Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee. Im Jahr 2010 ging Alpha Ventus vollständig ans Netz und speiste erstmals Strom in das deutsche Übertragungsnetz ein.
Alpha Ventus war nicht nur ein Energieprojekt, sondern auch ein groß angelegtes Forschungsfeld. Im Rahmen des RAVE-Programms (Research at Alpha Ventus) wurden zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt – etwa zu Wind- und Wellenverhältnissen, Materialbelastung und Korrosion, Auswirkungen auf Meerestiere, Vögel und Ökosysteme, Betriebssicherheit und Wartung in Offshore-Umgebungen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse trugen maßgeblich dazu bei, die Technik und Wirtschaftlichkeit späterer Offshore-Projekte zu verbessern.
Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 250 Gigawattstunden (GWh) kann Alpha Ventus rechnerisch etwa 70.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Dadurch werden jährlich rund 220.000 Tonnen CO₂ im Vergleich zu fossilen Energiequellen eingespart. Trotz hoher Kosten und technischer Risiken legte das Projekt den Grundstein für eine ganze Industrie.
Das Betreiberkonsortium (EWE, RWE und Vattenfall) hat im Mai 2025 beschlossen, den 60 MW-Windpark nicht weiter in seiner bisherigen Form zu betreiben, sondern auf eine Rückbau-Lösung hinzuarbeiten.Mit dem Programm RAVE („Research at Alpha Ventus“) wird bereits intensiv an Forschung zu diesem End-of-Life-Prozess gearbeitet – das Projekt dient damit nicht nur dem Rückbau, sondern als Lernfeld für die gesamte Branche
(Christian Dümke)