Gasspeicher: Wie ist die Rechtslage?
Es geht durch die Presse: Die deutschen Gasspeicher sind aktuell nur zu 67,66% gefüllt. In den letzten zwei Jahren betrug der Füllstand zu diesem Zeitpunkt noch rund 90%. Im Jahr 2022, als man wegen der Beendigung der Versorgung aus Russland kalten Winter fürchtete, hatte man die Speicher zu immerhin 75% voll.
Die Bundesregierung hält dies für unproblematisch, auch wenn der neuen LNG-Terminals. Deutschland kann heute – das ist unbestritten – mehr amerikanisches und norwegisches Flüssiggas kaufen als in der Vergangenheit. Eilige Regelwerke, die Geschäfte zur frühzeitigen Verdunkelung und Unternehmen zur Absenkung der Raumtemperatur verpflichten, sind in der Tat unwahrscheinlich. Doch wie sieht es rechtlich aus?
Tatsächlich ist der Füllstand der deutschen Gasspeicher keine rein privatwirtschaftliche Frage. § 35a – § 35h Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichten die Betreiber, Deutschland nicht noch einmal so in Bedrängnis zu bringen wie die Gazprom, die 2021 den größten deutschen Gasspeicher in Rehden leer laufen ließ, was die kurzfristige Abhängigkeit von der russischen Gasversorgung noch einmal drastisch erhöhte. Zwar hat die Bundesregierung die Gasspeicherbefüllungsverordnung inzwischen aufgehoben, auf deren Basis statt Gazprom seinerzeit die Trading Hub Europe (THE) das Speichermanagement übernahm. Aber die gesetzlichen Vorgaben gibt es nach wie vor. Sie laufen erst 2027 aus.
Hier schreibt nun § 35b Abs 1 EnWG vor, dass am jeweils 1. Oktober 80%, am 1. November 90% und am 1. Februar 30% Füllstand vorzuhalten sind. Aktuell besteht damit noch kein rechtswidriger Zustand, es spricht aber viel dafür, dass das Ziel zum 1. November nicht mehr erreichbar ist.
Doch was passiert, wenn am 1. November die Vorratskammern leer sind? Klappt es nicht, wird laut EnWG der Marktgebietsverantwortliche aktiv, wenn das Wirtschaftsministerium zustimmt oder dies anordnet. Zu deutsch: Die THE beschafft Mengen und bekommt das Geld für diese Maßnahmen ersetzt.Bislang wurden diese Gelder über die Gasspeicherumlage von den Gaskunden aufgebracht. Ab 2026 soll diese entfallen, das Geld soll wohl – das steht aber nicht fest – aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) ersetzt werden, in den die Gelder v. a. aus dem Emissionshandel fließen und der eigentlich den deutschen Weg zur Klimaneutralität ebnen soll.
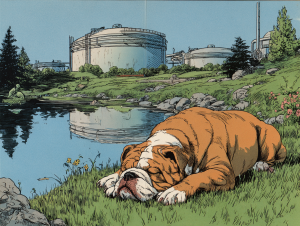
Was bedeutet das aktuell? Die Bundesregierung sieht keinen Grund zur Sorge. Es ist also eher nicht zu erwarten, dass sie den Füllstand durch aktive Maßnahmen erhöht. Gut möglich also, dass die Gasspeicher dieses und auch nächstes Jahr, bis die Vorgaben sowieso auslaufen, die gesetzlichen Füllstandsvorgaben unterschreiten, ohne dass aktiv dagegen gesteuert wird. Ist das Grund zur Sorge? Eher nicht, es sei denn, die weltpolitische Lage ändert sich noch einmal so drastisch, wie es aktuell nur schwer vorstellbar erscheint. Und in einer derzeit noch mittelfernen Zukunft ist Deutschland dann ja ohnehin von Erdgas zumindest fürs Heizen weitgehend unabhängig (Miriam Vollmer).

 Hintergrund der Klagen war der Umstand, dass beide Versorger im Jahr 2021 den jeweils betroffenen Kunden fristlos die bestehenden Energieversorgungsverträge gekündigt hatten, so dass diese gezwungen waren, sich kurzfristig und zu erheblich höheren Preisen von anderen Versorgern beliefern zu lassen. Die Versorger begründeten dieses Vorgehen mit den im Rahmen der Energiekrise aufgrund des Ukrainekrieges kurzfristig stark gestiegenen Beschaffungspreisen, die ein Festhalten an den Verträgen unzumutbar gemacht hätten.
Hintergrund der Klagen war der Umstand, dass beide Versorger im Jahr 2021 den jeweils betroffenen Kunden fristlos die bestehenden Energieversorgungsverträge gekündigt hatten, so dass diese gezwungen waren, sich kurzfristig und zu erheblich höheren Preisen von anderen Versorgern beliefern zu lassen. Die Versorger begründeten dieses Vorgehen mit den im Rahmen der Energiekrise aufgrund des Ukrainekrieges kurzfristig stark gestiegenen Beschaffungspreisen, die ein Festhalten an den Verträgen unzumutbar gemacht hätten.