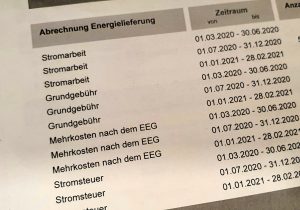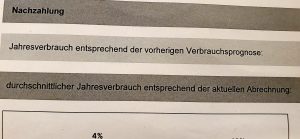Die doppeldeutige Ampel
Heute rief eine Radfahrerin in der Kanzlei an, die Ärger mit der Bußgeldstelle hatte. Nach einem Unfall mit mehrtägigem Krankenhausaufenthalt hatte sie der Unfallgegner angezeigt. Sie sei angeblich bei „Rot“ über die Ampel gefahren. Der entgegenkommende Kraftfahrer war links abgebogen und hatte sie dabei erwischt. Aus ihrer Sicht war es, wie sie auch gegenüber der Polizei angegeben hatte, erst „Gelb“ gewesen.
Nun, es wird sich wohl nicht mehr zweifelsfrei klären lassen. Wobei ein zweiter Blick auf deutsche Ampelschaltungen (eigentlich „Lichtsignalanlagenschaltungen“) sich oft lohnt. Eigentlich sollte man denken, dass Ampeln eindeutige Signale geben. Zumindest für eine der zwei Routen, deren Kreuzung sie möglichst konfliktfrei regeln sollen.
Tatsächlich gibt es oft zahlreiche unterschiedliche und mitunter doppeldeutige Signale: Die Fußgänger müssen schon warten, für die Kfz ist noch grünes Licht (oder wie im Fall der Radlerin: gelb). Noch komplizierter ist es, wenn auch noch eine extra Fahrradampel installiert ist. Aber als würde das nicht reichen, sind findige Verkehrsplaner in den Behörden auf die Idee gekommen, dass noch weiter optimiert werden kann. Bei Ampeln über mehrspurige Straßen gibt es oft Verkehrsinseln – und um zu verhindern, dass jemand darauf stehen bleiben muss, sind die Ampeln hier differenziert geschaltet. Manchmal so, dass abbiegende Kraftfahrer beim besten Willen nicht erkennen können, ob der entgegenkommende Fußgänger oder Fahrradfahrer nun „grün“ oder „rot“ hat.
Das lädt zu allgemeineren Betrachtungen über Regeln und Optimierung ein: Während Planer und Ökonomen gerne alles optimieren, um noch die letzte 10tel-Sekunde aus einer Ampelschaltung herauszuholen, setzen Juristen in der Regel eher auf Rechtsklarheit. Denn was nützt die besten Lichtzeichenanlage, wenn die Verkehrsteilnehmer nicht wissen, auf wen sie dort wann Rücksicht nehmen müssen. Aber auch unter Juristen gibt es Kollegen, die meinen, überall zugunsten von Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit Ausnahmen schaffen zu müssen. Letztlich geht diese Optimierung zu Lasten der Vorhersehbarkeit, Transparenz und Orientierungsfunktion rechtlicher Entscheidungen (Olaf Dilling).