Ausstieg aus dem Gasnetz – Referentenentwurf vom 4.11.2025
Die EU hat die Gasbinnenmarktrichtlinie reformiert, nun ist die Bundesrepublik am Zug. Sie muss den Rechtsrahmen für die Gasnetze neu setzen. Denn die Zeit drängt. 2045 will die Bundesrepublik treibhausgasneutral sein, also auch kein Erdgas mehr verbrennen. Das heutige Gasnetz muss also entweder andere Gase transportieren oder stillgelegt werden. Die Spielregeln für diesen geordneten Rückzug setzt das aktuelle Gesetzesvorhaben, das bis zur Sommerpause 2026 abgeschlossen sein soll. Derzeit lieg ein Referentenentwurf vom 4.11.2025 vor.
Der neue Verteilernetzentwicklungsplan
Zentrales Element des Entwurfs ist eine neue Pflicht für Betreiber von Gasverteilnetzen: Sie müssen einen Verteilernetzentwicklungsplan erstellen, sobald innerhalb der nächsten zehn Jahre eine dauerhafte Verringerung der Erdgasnachfrage zu erwarten ist, die eine Umstellung oder dauerhafte Außerbetriebnahme des Netzes oder einzelner Teile erforderlich macht (§ 16b Abs. 2 EnWG‑E). Dieser Plan ist regelmäßig zu aktualisieren (§ 16b Abs. 5 EnWG‑E).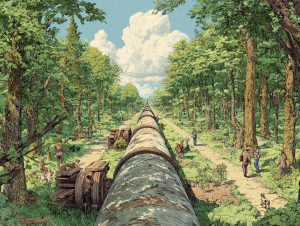
Dies soll auch nicht hinter dem Rücken der Öffentlichkeit passieren. Bereits die Entscheidung, einen solchen Plan zu erstellen, muss der Netzbetreiber unverzüglich auf seiner Internetseite veröffentlichen (§ 16c Abs. 1 EnWG‑E).
Transparenz und Beteiligung werden verpflichtend
Der Entwurf macht den Rückzug aus dem Gasnetz zu einem konsultationspflichtigen Prozess: Die Öffentlichkeit – insbesondere Netznutzer, Kommunen und Letztverbraucher – soll Stellung nehmen können. Entwürfe der Pläne und Konsultationsergebnisse sind online zu veröffentlichen (§ 16c Abs. 4 EnWG‑E). Zudem müssen die Pläne der zuständigen Regulierungsbehörde zur Bestätigung vorgelegt werden (§ 16c Abs. 5 EnWG‑E).
Inhaltliche Leitplanken: Alternativen müssen mitgedacht werden
§ 16d EnWG‑E enthält detaillierte Anforderungen. Die Pläne müssen u. a. kommunale Wärmepläne und Klimaziele berücksichtigen, Annahmen zur Nachfrageentwicklung nachvollziehbar darlegen und konkret ausweisen, welche Infrastruktur weiterbetrieben, umgestellt oder stillgelegt werden soll. Besonders relevant: Es muss beschrieben werden, ob für betroffene Letztverbraucher im Zeitpunkt der Umstellung oder Stilllegung hinreichende alternative Versorgungsmöglichkeiten bestehen.
Rechtsfolgen: Anschluss und Netzzugang können eingeschränkt werden
Lieg der Verteilernetzentwicklungsplan erst einmal vor, ändern sich die Spielregeln für den Letztverbraucher. Heute gibt es eine Netzanschlusspflicht. Künftig soll es eine solche Pflicht in den Netzen, die stillgelegt oder umgestellt werden sollen, nicht mehr geben: Der Netzanschluss kann ganz verweigert werden, wenn ein bestätigter Verteilernetzentwicklungsplan die Stilllegung/Umstellung vorsieht (§ 17 Abs. 2c Nr. 2 EnWG‑E). Auch der Netzzugang kann verweigert werden, wenn dies wegen der im bestätigten Plan vorgesehenen Stilllegung/Umstellung erforderlich ist (§ 20 Abs. 2a Nr. 2 EnWG‑E).
Anschlusstrennung ohne Zustimmung – mit sehr langen Fristen
Weitreichend ist § 17k EnWG‑E: Unter engen Voraussetzungen sollen Netzbetreiber Netzanschlüsse sogar ohne Zustimmung trennen dürfen, wenn die dafür erforderlichen Leitungen laut bestätigtem Plan stillgelegt/umgestellt werden. Das ist aber an umfangreiche Informationspflichten geknüpft (u. a. Hinweise zehn und fünf Jahre vorher sowie wiederholte Erinnerungen bis kurz vor dem Termin). Zusätzlich gilt eine Schutzklausel: Eine Trennung darf nicht erfolgen, wenn absehbar ist, dass die im Wärmeplan als besonders geeignet eingestufte Versorgungsart im betroffenen Gebiet nicht rechtzeitig verfügbar sein wird (§ 17k Abs. 2 EnWG‑E). Damit soll verhindert werden, dass der Versorger die Gasleitung kappt, obwohl die Fernwärmeleitung noch nicht fertig ist. Dort, wo es keine zentralen Einrichtungen geben wird, hilft dies aber nicht weiter: Es kann also durchaus sein, dass den letzten Kunden am Gasnetz gekündigt wird und sie gezwungen sind, sich für eine neue Heizung zu entscheiden.
Wie geht es nun weiter?
Der Referentenentwurf vom 4.11. wird nun innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und nach Beschluss durch das Kabinett in den parlamentarischen Prozess eingebracht. Es gibt bereits Stellungnahmen der Verbände, die auch das weitere Verfahren begleiten werden. Klar ist schon heute: Mit der Novelle 2026 trennen sich die Wege von Strom und Gas im EnWG. Stand bisher jeweils die Regulierung im natürlichen Monopol im Vordergrund, wird es nun darum gehen, die Stromnetze auszubauen und die leitungsgebundene Versorgung mit Erdgas über die nächsten zwei Jahrzehnte zu beenden (Miriam Vollmer)

 Erforderlich sind nach § 42c Abs. 1 Nr. 3 EnWG zwei Verträge, ein klassischer Liefervertrag zwischen Betreiber und Abnehmenden sowie ein Vertrag zur gemeinsamen Nutzung, in dem Energiemengen, Verteilungs- und Vergütungsschlüssel geregelt werden. Da der Kunde ja noch für die Differenzmengen einen anderen Lieferanten braucht, hat er also drei Stromlieferverträge, was für die Versorgung eines Privathaushalts seltsam überdimensioniert wirkt. Technisch verlangt § 42c eine 15-Minuten-Bilanzierung von Stromerzeugung und ‑verbrauch. Dienstleister können in den Betrieb, Vertragsabschluss und die Abrechnung eingebunden werden, was schnell zum Regelfall werden dürfte, denn den Anforderungen an einen Lieferanten sind auch in der abgespeckten Version absehbar nur Profis gewachsen.
Erforderlich sind nach § 42c Abs. 1 Nr. 3 EnWG zwei Verträge, ein klassischer Liefervertrag zwischen Betreiber und Abnehmenden sowie ein Vertrag zur gemeinsamen Nutzung, in dem Energiemengen, Verteilungs- und Vergütungsschlüssel geregelt werden. Da der Kunde ja noch für die Differenzmengen einen anderen Lieferanten braucht, hat er also drei Stromlieferverträge, was für die Versorgung eines Privathaushalts seltsam überdimensioniert wirkt. Technisch verlangt § 42c eine 15-Minuten-Bilanzierung von Stromerzeugung und ‑verbrauch. Dienstleister können in den Betrieb, Vertragsabschluss und die Abrechnung eingebunden werden, was schnell zum Regelfall werden dürfte, denn den Anforderungen an einen Lieferanten sind auch in der abgespeckten Version absehbar nur Profis gewachsen.